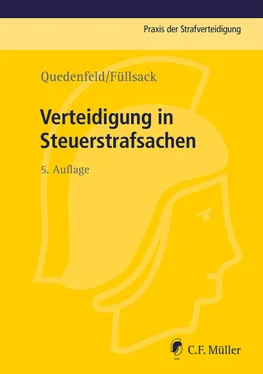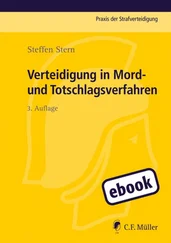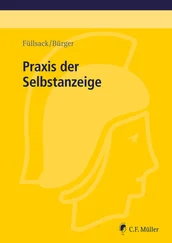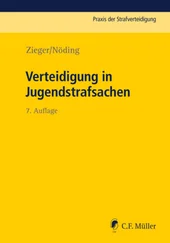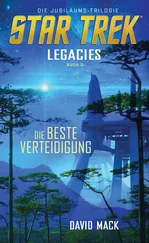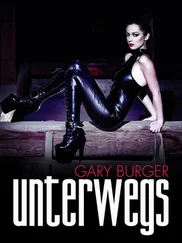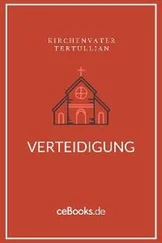[48]
Ebenso Bornheim S. 63; Bornheim wistra 1997, 261; Birkenstock wistra 2002, 47; Randt Rn. 46.
[49]
Blumers/Göggerle Rn. 96 ff.; Dahs 6. Aufl., Rn. 1080; Bornheim S. 63; Streck/Spatscheck Rn. 115.
[50]
Flore/Dörn/ Gillmeister S. 12.
[51]
Dahs 6. Aufl., Rn. 1080; Bornheim S. 73 f.
[52]
Vgl. Dahs 6. Aufl., Rn. 68, 167; Beulke/Ruhmannseder Rn. 82; Schlothauer Rn. 27 ff.; zur gemeinschaftlichen Verteidigung s.a. Beulke/Ruhmannseder Rn. 82.
[53]
Vgl. dazu Dahs Rn. 68; HK-StPO- Julius § 227 Rn. 3.
[54]
Zur Berechnung und Problematik der Beschränkung vgl. Meyer-Goßner/ Schmitt § 137 Rn. 5 f.; HK-StPO- Julius § 137 Rn. 9.
[55]
KK- Laufhütte/Willnow § 141 Rn. 6; Meyer-Goßner/ Schmitt § 141 Rn. 5.
[56]
Str.; vgl. die Nachweise bei Meyer-Goßner/ Schmitt § 140 Rn. 23; HK-StPO- Julius § 140 Rn. 12.
[57]
Vgl. die Beispiele bei Meyer-Goßner/ Schmitt § 140 Rn. 26; HK-StPO- Julius § 140 Rn. 13 ff.
[58]
KK- Laufhütte/Willnow § 142 Rn. 7; Meyer-Goßner/ Schmitt § 142 Rn. 9.
[59]
BVerfGE 68, 256; BGH NJW 1988, 3273; Meyer-Goßner/ Schmitt § 142 Rn. 9; HK-StPO- Julius § 142 Rn. 4; zurückhaltend KK- Laufhütte/Willnow § 142 Rn. 7.
[60]
HK-StPO- Julius § 142 Rn. 9.
[61]
Meyer-Goßner/ Schmitt § 142 Rn. 12 mit Nachweis zur divergierenden Rspr.; HK-StPO- Julius § 142 Rn. 7.
[62]
Vgl. als Beispielsfall LG Gera NStZ-RR 2006, 290; HK-StPO- Julius § 141 Rn. 7 m.w.N.
[63]
OLG Hamm StV 1989, 242; OLG Frankfurt StV 1989, 384; 1991, 9; OLG Stuttgart StV 1990, 55.
[64]
Vgl. KK- Laufhütte/Willnow § 141 Rn. 12 m.w.N.; Meyer-Goßner/ Schmitt § 142 Rn. 19.
[65]
Vgl. hierzu oben letzte Fn. zu Rn. 12.
[66]
Vgl. KK- Laufhütte/Willnow § 141 Rn. 8 mit der dort zitierten Rspr.; HK-StPO- Julius § 141 Rn. 8.
[67]
Der zusätzlich bestellte Pflichtverteidiger wird auch als Sicherungsverteidiger bezeichnet, vgl. Beulke Strafprozeßrecht, Rn. 170; kritisch dazu HK-StPO- Julius § 141 Rn. 8.
[68]
Vgl. OLG Frankfurt StV 1983, 234; OLG Düsseldorf wistra 1994, 318.
[69]
Vgl. Dahs Rn. 150.
[70]
Zu den Einzelheiten vgl. Mertens/Stuff/Mück Rn. 17 ff.
[71]
Zur Kalkulation vgl. Mertens/Stuff/Mück Rn. 122 ff.
[72]
Zu den Einzelheiten vgl. Mertens/Stuff/Mück Rn. 17 ff.
Teil 1 Allgemeine Grundfragen› II. Besteuerungs- und Steuerstrafverfahren
II. Besteuerungs- und Steuerstrafverfahren
58
Besteuerungs- und Steuerstrafverfahren[1] stehen unabhängig und gleichrangig nebeneinander.[2] Die Rechte und Pflichten der Steuerpflichtigen und der Finanzbehörden im Besteuerungsverfahren und im Steuerstrafverfahren richten sich gemäß § 393 Abs. 1 AOnach den für das jeweilige Verfahren geltenden Vorschriften.
59
Nach den Besteuerungsgrundsätzen der Abgabenordnung sind die Finanzbehörden einerseits zuständig für die Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen im Besteuerungsverfahren §§ 88 ff., 193 ff. AO, andererseits ermittelt die Finanzbehörde zugleich bei Verdacht einer Steuerstraftat den Sachverhalt im Strafverfolgungsinteresse, § 386Abs.1AO.[3] Die steuerstrafrechtlichen Ermittlungen werden von den Straf- und Bußgeldsachen- oder Steuerfahndungsstellen als Spezialdienststellen durchgeführt.[4] Die Veranlagungs- und Betriebsprüfungsbeamten sollen demgegenüber gerade nicht zur steuerstrafrechtlichen Ermittlung tätig werden. Diese innerbehördliche Kompetenzverteilung ändert aber nichts daran, dass wegen der Zuständigkeit der Finanzbehörden (Hauptzollamt, Finanzamt, Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) und Familienkasse) zur Verfolgung von Steuerstraftaten grundsätzlich jeder im Besteuerungsverfahren Handelnde zugleich die Aufgabe hat, Steuerstraftaten zu erforschen, § 386 Abs. 1 S. 1 u. 2 AO, und sogar die Befugnis zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens besitzt, § 397 Abs. 1 AO.[5] Die in der Strafverfolgungspraxis bei Steuerstraftaten mit den weitgehendsten Rechten ausgestattete Steuerfahndung hat mit steuerstrafrechtlichen , § 208 Abs. 1 Nr. 1 AO, sowie steuerrechtlichen , § 208 Abs. 1 Nr. 2, 3 AO, Befugnissen eine Doppelfunktion.[6]
60
Das Nebeneinander von Besteuerungs- und Strafverfahren bringt den Steuerpflichtigen in eine Konfliktsituation zwischen dem weit gespannten Fächer von steuerlichen Erklärungs-, Auskunfts- und Einsichtsgewährungspflichten (§§ 90 Abs. 1-3, 93 Abs.1, 97 Abs.1, 100 Abs.1, 200 Abs.1–3 AO) und seinen aufgrund der strafrechtlichen Interessenlage strafprozessual verbrieften Rechten, zum Tatvorwurf zu schweigen und sich nicht selbst wegen einer Steuerstraftat belasten zu müssen ( nemo tenetur se ipsum accusare ; §§ 136 Abs. 1 S. 2, 163a Abs. 4 S. 2, 243 Abs. 5 S.1 StPO).[7]
61
Diesem Zwiespalt versucht der Gesetzgeber in § 393 Abs. 1 S. 2 AORechnung zu tragen.[8] Auch wenn der Steuerpflichtige im Besteuerungsverfahren kein Aussageverweigerungsrecht besitzt, darf nach geltendem Recht die Finanzbehörde von den ihr im Besteuerungsverfahren zustehenden Zwangsmitteln, §§ 328 ff. AO,[9] insoweit keinen Gebrauch machen, als sich der Betroffene damit eines steuerstrafrechtlichen Verhaltens selbst bezichtigen würde. § 393 Abs. 1 S. 3 AOregelt das Zwangsmittelverbot nach Einleitung des Strafverfahrens. Ist das Steuerstrafverfahren eingeleitet , entfällt ausnahmslos („ stets“ ) die Erzwingbarkeit von Auskünften und Mitwirkungspflichten im Steuerverfahren, wenn sich der Beschuldigte dadurch in die Gefahr der strafrechtlichen Selbstbelastung begibt. Von diesem Zeitpunkt an wird unwiderleglich vermutet , dass der Einsatz von Zwangsmitteln den Steuerpflichtigen in die Gefahr der Selbstbelastung bringen würde, ungeachtet einer konkreten Selbstbelastungsgefahr.[10] In § 393 Abs. 1 S. 4 AOschließt sich eine gesetzliche Belehrungspflicht über die aus § 393 Abs. 1 AO sich ergebende Rechtslage an. Der Steuerpflichtige ist dabei auf
| • |
die Selbstständigkeit beider Verfahrenund die sich aus ihnen ergebenden Mitwirkungspflichten im Besteuerungsverfahren , |
| • |
das Verbot der Anwendung von Zwangsmitteln im Besteuerungsverfahren (S. 2) und im Strafverfahren (S. 3)hinzuweisen.[11] |
Üblicherweise argumentiert die Steuerverwaltung allerdings, der Steuerpflichtige, der sich einer Steuerhinterziehung strafbar gemacht habe, wisse selbst sehr genau, wann er sich durch eigene Aussagen gegenüber der Finanzverwaltung belaste und müsse daher nicht extra belehrt werden.
62
Sehr schnell wird ersichtlich, dass die gesetzliche Regelung in § 393 Abs. 1 AOeher eine Problembeschreibung darstellt, als dem Steuerpflichtigen bei der Wahrnehmung seiner strafprozessualen Rechte in der Praxis des steuerstrafrechtlichen Ermittlungsverfahrens eine wesentliche Hilfe an die Hand zu geben. Die für den beschuldigten Steuerpflichtigen neuralgischen Fragen der faktischen „ Druckausübung “ des Finanzamtes auf vielfältige Weise sind vom Gesetzgeber mit der Begrenzung der Zwangsmittel letztlich auf das Zwangsgeld (§ 329 AO) dem Wortlaut nach nicht geregelt. Unmittelbare Drucksituationen[12] mit Selbstgefährdungspotenzialergeben sich für den Steuerpflichten etwa aus folgenden Situationen:
Читать дальше