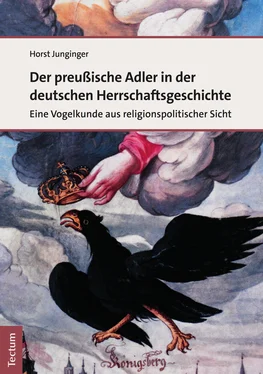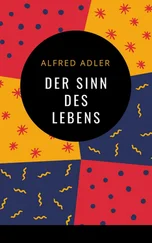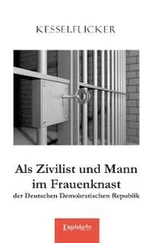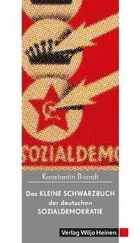Für das Fernbleiben vom Gottesdienst sah das kurfürstliche Kriegsrecht schwere Strafen vor. Keinesfalls durfte „bey Vermeidung der Straffe des Halss Eisens“ die morgendlichen und abendlichen Betstunden im Feldlager versäumt werden. Stand ein „Treffen oder Sturm“ bevor, wurde eine „extra Bet-Stund“ mit „öffentlicher Beicht und ertheilter General-Absolution“ angesetzt (Bamberg 26). Abschließend sollte ein „schicklich Gebet“ rezitiert werden und das Regiment gemeinsam niederknien: „An solchen Actu würde die Devotion nicht wenig vermehret“ (ebd. 31 f.). Die Feldprediger hatten die Aufgabe, den Soldaten die Angst vor dem Tod zu nehmen und ihnen auch in Extremsituationen die Pflicht zum Gehorsam vor Augen zu halten. Mit dem Ausbau des Militärkirchenwesens setzte Friedrich Wilhelm I. das existierende System der Truppenbetreuung fort. Unter Beibehaltung des alten Mottos „Gut gebetet ist immer halb gesiegt.“ (Weigert 25 f.) wurde es von ihm aber deutlich besser und effizienter organisiert.
Berücksichtigt man noch den militärischen Drill, wurden in Potsdam perfekte Kämpfer und Soldaten herangebildet. In Kombination mit eiserner Disziplin und härtesten Strafen verhalfen ihnen Gottesfurcht und religiöser Glaube dazu, ihre Einsätze selbständig durchzuführen und als freiwillige Pflichterfüllung aufzufassen. Das Prinzip der preußischen Freiwilligkeit bestand aus bedingungsloser Subordination und hatte in der doppelten Furcht vor irdischen und überirdischen Strafmaßnahmen seine wichtigste Stütze.
„Was bei dem gemeinen Mann durch den Appell an das Ehrgefühl nicht bewirkt werden konnte, das musste durch eine strenge, eiserne Disziplin erreicht werden. Dieselbe beruhte vor allem auf dem Grundsatze der unbedingten Subordination, d. i. nicht der passiven Untertänigkeit und Unterwürfigkeit, sondern jenes militärischen Gehorsams, dessen Betätigung sittliche Tüchtigkeit und Selbstbeherrschung erfordert.“ (Preußens Heer 9)
Verstöße gegen die militärische Dienstpflicht wurden deswegen mit Züchtigung, Arrest, Gassenlaufen und nicht selten mit der Todesstrafe „durch Pulver und Blei“ geahndet.
„Durch diese eiserne Disziplin gelang es, die rohe Masse für die hohe Aufgabe des Kriegsheeres, den Schutz der Heimat und des Vaterlandes, heranzubilden und sie mit dem Geiste der mannhaften Zucht und der strengen Pflichterfüllung zu durchdringen, – Eigenschaften, deren Wert noch gesteigert wurde, als die sittlichen Hebel der Kriegerehre, Vaterlandsliebe und Königstreue, hinzukamen.“ (Ebd.)
Gottesfurcht im Plural
Der Soldatenkönig war ein ausgesprochen frommer Mensch und wusste um die segensreiche Wirkung der Religion, sei es im Krieg oder im Frieden. Nicht umsonst verzichtete er während seiner gesamten Amtszeit auf den Bau von Schlössern, um stattdessen die Finanzmittel des Staates auf die Erweiterung des Kirchen- und Armeewesens zu konzentrieren. Allein auf dem Stadtgebiet Potsdams ließ er neun Kirchen errichten, wobei eine Mischung aus religiösen, landespolitischen und militärischen Zielen sein Vorgehen leitete (Völkening 746). So entstanden Kirchen für den König, Kirchen für Fremde und Kirchen für Bürger (Bauch 2007).
Hatte das Potsdamer Toleranzedikt von 1685 das Verbot der öffentlichen Ausübung des katholischen Glaubens ausdrücklich fortgeschrieben, sah sich Friedrich Wilhelm I. aus einem sehr profanen Grund veranlasst, es vier Jahrzehnte später wieder außer Kraft zu setzen: Für die 1722 gegründete Königlich Preußische Gewehrfabrique benötigte er katholische Arbeiter aus Lüttich, die nicht nach Potsdam gekommen wären, wenn ihnen außer dem Branntweinkonsum nicht auch die freie Religionsausübung und der Dispens vom Kantonreglement zugestanden worden wäre. Ihnen ließ er auf dem Hof der Gewehrfabrique eine Kapelle errichten, die wegen „Aufwuchs des Heeres“ allerdings schon 1738 durch ein größeres Kirchengebäude ersetzt werden musste (Hafner 321).
In Anbetracht seines reformierten Glaubens lag es nahe, dass der König die Ansiedlung hugenottischer Glaubensflüchtlinge zu fördern suchte. Etwa 20000 der im katholischen Frankreich verfolgten Hugenotten hatten sich in Brandenburg-Preußen niedergelassen. Mit dem Koloniepatent von 1731 gewährte er ihnen ökonomische und politische Privilegien, um sie zur Übersiedlung nach Potsdam zu bewegen (Kamp 47). Außer an hugenottischen Fabrikanten hatte der König vor allem Interesse an militärischem Führungspersonal. Offiziersflüchtlinge calvinistischer Konfession übernahmen im Laufe der Zeit „in allen Rängen und Einheiten der preußischen Militärstruktur“ wichtige Positionen (Willems 45). Am Namen einer aus Maizières-lès-Metz stammenden Hugenottenfamilie zeigt sich der Erfolg dieser Politik bis in die Gegenwart. Als am 17. Juni 1987 in Iserlohn das Glockenspiel der Potsdamer Garnisonkirche an das Fallschirmjägerbataillon 273 übergeben wurde, hielt nicht zufällig General a. D. Ulrich de Maizière eine der Ansprachen. Mit seinem Sohn Thomas de Maizière setzt sich heute sogar ein ehemaliger Verteidigungsminister für den Wiederaufbau der Garnisonkirche ein.
Für die dem König 1718 von Zar Peter dem Großen geschenkten 55 Russen kam am Anfang der Legationspope aus Berlin zur seelsorgerlichen Betreuung nach Potsdam. Als die Zahl orthodoxer Soldaten innerhalb weniger Jahre auf 300 Personen anstieg, wurde ihnen in einem Anbau zum „Langen Stall“, dem an die Garnisonkirche anschließenden Reit- und Exerzierhaus, ein Gotteshaus errichtet. Der König ließ es sich nicht nehmen, im April 1734 höchstselbst bei der Einweihung der „Moskovitischen Kirche“ teilzunehmen (Völkening u. a. 352). Da die russische Kaiserin Anna Iwanowna zusicherte, einen Popen als geistliches Oberhaupt abzustellen, erhielt die Gründung der orthodoxen Gemeinde eine offizielle Note mit außenpolitischer Reichweite. 1739 gelangten außerdem 22 muslimische Türken als Geschenk in die Potsdamer Garde. „Sie bekamen für ihr am Sonntag (!) stattfindendes Freitagsgebet einen Raum im Militärwaisenhaus zugewiesen.“ (Fischbacher 49) In Wirklichkeit handelte es sich bei den „Türken“ um tatarische Kriegsgefangene, die der Herzog von Kurland dem König von Preußen spendiert hatte. Friedrich der Große nahm ab 1741 in verstärktem Umfang tatarische und bosnische Lanzenreiter muslimischen Glaubens in die Armee auf, deren Einsatzgebiet vor allem in Schlesien und Ostpreußen lag (Sanci 545).
Um Kosten zu sparen, erfolgte die Unterbringung der Soldaten in Privathäusern. Das war zwar billiger, brachte aber Probleme eigener Art mit sich. Durch die fehlende Kasernierung war es schwierig, die Militärangehörigen unter Kontrolle zu halten und Streitereien untereinander, aber auch Konflikte mit der Zivilbevölkerung zu verhindern. Aus der Perspektive des Regenten fiel der Religion deswegen eine wichtige ordnungspolitische Funktion zu, die auch dann nicht geringer wurde, als sich die religiösen Verhältnisse in Potsdam auffächerten. Der bikonfessionelle Proporz zwischen Lutheranern und Reformierten in Preußen hatte bereits durch den Einfluss des Halleschen Pietismus eine innerprotestantische Erweiterung erfahren. In Halle war am Portal des Haupthauses der Franckeschen Stiftungen eine Abbildung mit zwei zur Sonne aufstrebenden Adlern angebracht, unter der das Bibelzitat aus Jesaja 40, Vers 31 zu lesen stand: „Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler.“
Wilhelmine, die älteste Tochter Friedrich Wilhelms I., brachte in ihren Erinnerungen ein wenig schönes Sittenbild über das Leben am Hof und die Misshandlungen, denen sie und ihr Bruder Friedrich ausgesetzt waren, zu Papier. Der unter dem Einfluss August Hermann Franckes stehende König behandelte seine Kinder wie innerfamiliäre Untertanen. In seiner bigotten Frömmigkeit entsagte er allen geistigen Genüssen, der Musik ebenso wie der Literatur. Doch auf der anderen Seite frönte er dem exzessiven Essen und Trinken. Vor allem das brandenburgische Bier hatte es ihm angetan, dem bei den Tabakskollegien kräftig zugesprochen wurde. Die Völlerei ließ sein Körpergewicht bei einer Größe von 1,65 Metern schließlich auf 150 Kilogramm ansteigen. Wohlstandskrankheiten wie Gicht oder Wassersucht suchten allerdings nicht nur ihn heim. Sie ziehen sich „wie ein roter Faden durch die Familiengeschichte der Hohenzollern“ (Kuhl 2012). Später ließ sich der Soldatenkönig in einer Sänfte herumtragen.
Читать дальше