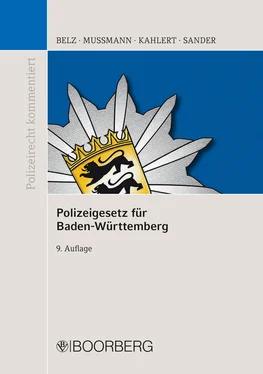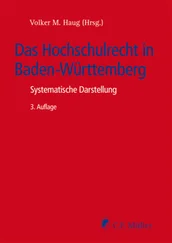a) Der Grundsatz der Geeignetheit
b) Der Grundsatz des geringsten Eingriffs (Abs. 1)
c) Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit i. e. S. (Abs. 2)
1. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
1
§ 5 enthält eine Teilregelungdes Grundsatzesder Verhältnismäßigkeiti. w. S., auch Übermaßverbot genannt. Dieser Grundsatz wird zumeist aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleitet, ergibt sich aber bereits aus dem Wesen der Grundrechte selbst. Er enthält drei Komponenten, wobei die Terminologie nicht einheitlich ist:
– Grundsatz der Geeignetheit,
– Grundsatz des geringsten Eingriffs(auch Grundsatz der Erforderlichkeit oder des mildesten Mittels genannt), Abs. 1,
– Grundsatz der Verhältnismäßigkeiti. e. S. (auch Grundsatz der Angemessenheit oder Proportionalität genannt), Abs. 2.
Diese Komponenten sind in dieser Reihenfolge zu prüfen, weil dadurch der polizeiliche Handlungsspielraum zunehmend eingeengt wird.
2
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bindet jedespolizeiliche Handelnohne Weiteres. Darüber hinaus weist das Polizeigesetz außer in § 4 an mehreren Stellen auf diesen Grundsatz hin, so z. B. in §§ 9 Abs. 1, 33 Abs. 1 Nr. 1 und 3, 31 Abs. 3, 36 Abs. 1 Nr. 1 und vor allem in den Bestimmungen über den Polizeizwang (§ 63 ff.). Zur Bindung des Ermessens durch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit s. o. § 3, RN 32.
2. Die Komponenten des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit
a) Der Grundsatz der Geeignetheit
3
Geeignet sind nur solche Maßnahmen, die zur Gefahrenabwehr als legitimem Ziel dieser Maßnahme auch tauglichsind. Es genügt, wenn sie einen Beitragzur Erreichung dieses Ziels leisten, komplette Gefahrenabwehr ist also nicht Voraussetzung, ein „Schritt in die richtige Richtung“ reicht aus. Ungeeignet und damit rechtswidrig ist eine Maßnahme erst dann, wenn sie sich als objektiv oder evident untauglich erweist (VGH BW, VBlBW 2004, 20, 24).
Beispiel:Auch wenn es in Folge einer Videoüberwachung zu einer Verlagerung der Kriminalität kommt, ist sie nicht ungeeignet, da es nach h. M. zumindest im überwachten Bereich zu einer Abnahme der Kriminalität kommt (VGH BW, VBlBW 2004, 20, 24).
Für die Beurteilung der Geeignetheit ist auf den Zeitpunkt des Erlassesder Maßnahmen (exante) und auf die dort vorliegenden Tatsachen und Erkenntnisse abzustellen. Eine Maßnahme wird also nicht fehlerhaft, wenn sich ihre Ungeeignetheit später herausstellt.
4
Nicht geeignet sind Maßnahmen, die etwas Unmögliches anordnen. Wird z. B. durch eine Polizeiverfügung etwas tatsächlich Unmöglichesaufgegeben, ist diese Verfügung nichtig, § 44 Abs. 2 Nr. 4 LVwVfG.
Beispiel:Die Anordnung, einen Platz innerhalb von 15 Minuten zu räumen, wenn der Abmarsch sichtbar für längere Zeit blockiert ist.
Rechtswidrig oder nichtig sind grundsätzlich auch solche Maßnahmen, die etwas rechtlich Unmögliches, also etwas, das gegen öffentliches oder privates Recht verstößt, anordnen.
Beispiel:Anlässlich einer Fahrzeugkontrolle wird festgestellt, dass der Fahrer betrunken ist. Die an den Beifahrer gerichtete Anordnung, den Fahrer nach Hause zu fahren, ist rechtswidrig, wenn dieser keinen Führerschein hat (vgl. § 1 Abs. 1 StVZO).
Ergeht in Fällen einer dinglichenoder obligatorischen Mitberechtigungeine polizeiliche Anordnung nur an einen der Mitberechtigten, wird diesem etwas zivilrechtlich Unmögliches aufgegeben, wenn der oder die andere(n) Mitberechtigte(n) mit dem Angeordneten nicht einverstanden ist (sind).
Beispiel:Die Polizei ordnet die Beseitigung eines morschen Baumes, der auf die Straße zu stürzen droht, gegenüber A an. Eigentümer des Grundstücks sind A und B, die beide nichts unternehmen wollen. Die Verfügung gibt dem A etwas rechtlich Unmögliches auf, da er gegen den Willen des B nicht allein über die Sache verfügen darf (vgl. § 747 Satz 2 BGB).
Dieser Umstand führt nach h. M. nicht ohne Weiteres zur Rechtswidrigkeit dieser Maßnahme, sondern ist zunächst nur ein Vollstreckungshindernis, das durch den Erlass einer (Duldungs-)verfügung gegenüber dem bzw. den anderen Mitberechtigten ausgeräumt werden kann (VGH BW, VBlBW 1982, 405, 406; 1984, 19; 1991, 27).
5
Wird dem Störer etwas subjektiv Unmöglichesaufgegeben (ihm fehlen z. B. die finanziellen Mittel oder die persönlichen Fähigkeiten), so kann dies zur Ungeeignetheit einer gegen ihn gerichteten polizeilichen Verfügung führen, entbindet aber nicht von der Verantwortlichkeit und damit auch nicht von der Kostenpflicht, wenn die Polizei die Gefahr mit eigenen Mitteln beseitigt.
Beispiel:A hat sein Schrottauto auf der Straße abgestellt. Stellt das Fahrzeug keine akute Gefährdung dar, wäre eine Beseitigungsanordnung ihm gegenüber geeignet, selbst wenn er vorträgt, er könne das Abschleppen nicht bezahlen. Falls er sich nicht finanzielle Mittel besorgen kann, wäre die Anordnung zumindest Grundlage für eine Ersatzvornahme. Ist jedoch von vornherein klar, dass A nicht handeln kann und besteht eine akute Gefahrenlage, wäre eine Verfügung ihm gegenüber zur Gefahrenabwehr ungeeignet. Die Polizei müßte die Maßnahme selbst nach § 8 ausführen, und zwar auf Kosten des A.
b) Der Grundsatz des geringsten Eingriffs (Abs. 1)
6
Kommen mehrere gleich geeigneteMaßnahmen zur Gefahrenabwehr in Betracht, so muss die Polizei die Maßnahme treffen, die den Einzelnen und die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt. Dieses Gebot, das mildeste Mittel anzuwenden, gilt hinsichtlich der Artund des Inhaltsvon Maßnahmen.
Beispiele:Bevor eine Versammlung verboten wird, müssen mildere Mittel ausgeschöpft und Kooperationsgespräche zur Verhinderung der Gefahr gescheitert sein (VGH BW, VBlBW 1993, 343).
Können Gefahren bei einer erlaubnispflichtigen Tätigkeit durch die Beifügung einer Auflage abgewehrt werden, wäre das Verbot der Tätigkeit nicht das mildeste Mittel (BVerwG, GewArch 1996, 425). Das Abschleppen eines Kfz zu einer abgelegenen „Sammelstelle“ ist nicht der geringste Eingriff, wenn ein Versetzen des Kfz möglich ist und die Gefahr beseitigt.
Das Abschleppen eines Kfz ist grundsätzlich auch dann rechtmäßig, wenn der Fahrer seine Visitenkarte und Handy-Nummer sichtbar im Fahrzeug deponiert (BVerwG, NJW 2002, 2122; OVG Hamburg, NJW 2001, 168; VGH BW, VBlBW 2003, 74, 284).
Eine besondere Rolle hat der Grundsatz des geringsten Eingriffs bei der Ausgestaltung der Vorschriften über die Anwendung unmittelbaren Zwangs (§§ 66 ff.) gefunden (s. u. § 63, RN 24 f.). Der Grundsatz des geringsten Eingriffs gilt ferner bei der Auswahlunter mehreren Störern oder Nichtstörern (s. u. § 6, RN 21 und § 7, RN 14 f.).
Beispiel:Die Beschlagnahme einer Mietwohnung zur Beseitigung von Obdachlosigkeit kann ein milderes Mittel als die Beschlagnahme von Hotelzimmern sein, wenn durch erstere lediglich die freie Auswahl der Mieter eingeschränkt wird, durch letztere aber weitergehende Folgewirkungen (Imageverlust, Ruin) zu befürchten sind (vgl. OVG Schleswig, NJW 1993, 413).
7
Zum Inhalt des Grundsatzes des geringsten Eingriffs gehört auch, dass dem Betroffenen auf Antrag gestattet wird, ein anderes ebenso wirksames Mittel anzuwenden, sofern die Allgemeinheit dadurch nicht stärker beeinträchtigt wird – Austauschmittel –(VGH BW, VBlBW 1981, 116, 119; GewArch 1994, 489, 493).
Читать дальше