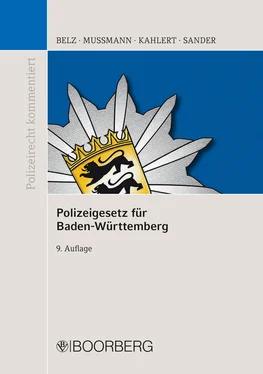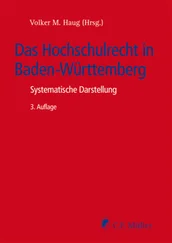5
Die Polizei kann andererseits verpflichtet sein, zum Schutz des Lebenstätig zu werden, etwa zur Verhinderung der Begehung einer Selbsttötung (§ 33 Abs. 1 Nr. 2 c), zur Rettung eines Verunglückten oder um eine aktive Sterbehilfe zu untersagen (VG Karlsruhe, NJW 1988, 1536, 1537; VGH BW, NVwZ 1990, 378).
b) Recht auf Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG)
6
Freiheit der Person bedeutet körperliche Bewegungsfreiheit. Sie kann durch Freiheitsbeschränkungen oder Freiheitsentziehungen eingeschränkt werden, wobei für Letztere die besonderen Verfahrensvorschriften des Art. 104 Abs. 2 GG (Richtervorbehalt) zu beachten sind. Im Übrigen ist die Abgrenzung nicht immer problemlos.
7
Eine Freiheitsentziehungliegt vor, wenn jemand durch die öffentliche Gewalt an einem bestimmten eng umgrenzten Ortfestgehalten wird. Dazu gehören z. B. das Festhalteneiner Person und ihre Mitnahme zur Dienststelle (Sistierung)anlässlich einer Personenfeststellung (§ 27), der polizeiliche Gewahrsam(§ 33), zu dem auch die Einkesselung(Einschließung) und der sog. Wanderkessel(einschließende Begleitung) gehören, und ferner die Vorführungeiner Person nach § 28 Abs. 3.
8
Freiheitsbeschränkungensind alle übrigen Einschränkungen der körperlichen Bewegungsfreiheit, wie z. B. das Anhalteneiner Person anlässlich einer Befragung (§ 43 Abs. 1 Satz 10), anlässlich einer Maßnahme nach § 51 Abs. 4 oder einer Personenfeststellung (§ 27 Abs. 2), sofern dieses über den flüchtigen Augenblick hinausgeht, oder die vollständige Abriegelungeines Ortes für mehrere Stunden durch Polizeibeamte (OVG Lüneburg, NVwZ-RR 2007, 103).
c) Versammlungsfreiheit (Art. 8 Abs. 1 GG)
9
Die Anwendung von Ermächtigungsgrundlagen aus dem PolG für Maßnahmen, die sich an Versammlungen richten, wird vom verfassungsrechtlichen Grundsatz der Polizeifestigkeitvon Versammlungen begrenzt. Das Recht, öffentlicheVersammlungen (zur Versammlungseigenschaft vgl. BVerwG, DÖV 2007, 883; NVwZ 2007, 1431, 1434; VGH BW, VBlBW 2008, 60) und Aufzüge zu veranstalten und an solchen teilzunehmen, wird durch das Versammlungsgesetzkonkretisiert. Dieses regelt abschließend, unter welchen Voraussetzungen derartige Veranstaltungen durchgeführt, beschränkt oder verboten werden dürfen.
Beispiele:Eine öffentliche Versammlung kann nur durch eine Auflösung nach § 15 Abs. 2 VersG, nicht aber auf der Grundlage der polizeilichen Generalklausel oder über polizeiliche Standardmaßnahmen, insbesondere durch eine Ingewahrsamnahme in Form der Einkesselung, beendet werden (BVerwG, NVwZ 1988, 250; VGH BW, NVwZ 1998, 761; OVG NW, DVBl. 2001, 839, 840).
Ein Platzverweis, § 27 a, ist unzulässig, solange sich die Person in einer Versammlung befindet (BVerfG, NVwZ 2005, 80, 81; VGH BW, VBlBW 2008, 60 – stille Mahnwache).
Damit wird die Anwendbarkeit anderer Gesetze zur Gefahrenabwehr, z. B. Straßenrecht, Baurecht, Seuchenrecht, nicht ausgeschlossen, sofern damit nur mittelbareAuswirkungen auf die Versammlungsfreiheit verbunden sind (VGH BW, NVwZ 1998, 761, 763).
Als zulässig werden ferner sog. Vorfeldmaßnahmenaufgrund des Polizeigesetzes angesehen, z. B. die Personenfeststellung oder die Durchsuchung von Personen und Sachen bei anreisenden Versammlungsteilnehmern, sofern hierdurch die Versammlung weder zeitlich beschränkt noch unmöglich gemacht wird. Eine Gefährderansprachenach dem neuen § 29, mit der die Polizei einer Person signalisiert, dass sie unter Beobachtung steht und welche polizeilichen Maßnahmen im Fall einer Störung gegen sie ergriffen werden, zielt darauf ab, den Betroffenen von einer Störung abzuhalten. Aufgrund dieser Abschreckungswirkung, die Einfluss auf die Entschließungsfreiheit der betroffenen Person nehmen soll, kann es im Einzelfall auch zu Eingriffen in Art. 8 Abs. 1 GG kommen, weswegen die Versammlungsfreiheit nunmehr in die Liste der einschränkbaren Grundrechte aufgenommen wurde.
Polizeirechtliche Befugnisse stehen als Mittelzur Abwehr unmittelbarer Gefahren i. S. des § 15 VersGzur Verfügung (BVerwG, NJW 1982, 1008; OVG Bremen, NVwZ 1990, 1188, 1189) und auch dann, wenn sie das mildere Mittelgegenüber den versammlungsrechtlich zulässigen Maßnahmen („Minusmaßnahmen“) sind, wie etwa die Anordnung, einen gewissen Abstand gegenüber Personen oder Sachen einzuhalten (BVerfG, NVwZ 2005, 80, 81).
10
Für nicht öffentlicheVersammlungen gilt das Versammlungsgesetz nur teilweise (z. B. §§ 3, 21, 23, 28 VersG). Ob im Übrigen die Vorschriften des Polizeigesetzes herangezogen werden können, ist umstritten, wird jedoch überwiegend im Grundsatz bejaht. Dann ist z. B. die Generalklausel (§§ 3, 1 Abs. 1) Rechtsgrundlage für ein Versammlungsverbot.
11
Die Vorschriften des Polizeigesetzes finden uneingeschränkt Anwendung, wenn es darum geht, rechtmäßige Versammlungen vor externen Störungenzu schützen (VGH BW, NVwZ-RR 1990, 602, 603). Nur in absoluten Ausnahmefällen ist es zulässig, in derartigen Situationen die Versammlung selbst zu unterbinden (s. u. § 9, RN 5).
12
Sofern das Versammlungsgesetz nicht selbst den Polizeivollzugsdienst zum Handeln ermächtigt (vgl. §§ 12, 12 a, 13, 18 Abs. 3), bestimmt sich die Zuständigkeitfür Maßnahmen nach diesem Gesetz nach der Verordnung des IM über die Zuständigkeiten nach dem Versammlungsgesetz und hiernach sind grundsätzlich die Kreispolizeibehörden zuständig.
d) Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Art. 10 GG)
13
Die Befugnis, dieses (einheitliche) Grundrecht durch Maßnahmen aufgrund des Polizeigesetzes einzuschränken, wurde erstmals mit dem ÄndG 2008 geschaffen. Gleichzeitig nahm der Gesetzgeber mit § 23 a a. F. eine Norm auf, die es dem Polizeivollzugsdienst erlaubt, Verkehrsdaten der Telekommunikation zu erheben und technische Mittel einzusetzen, um den Standort eines Mobilfunkendgerätes sowie die Kennung eines Telekommunikationsanschlusses oder eines Endgerätes zu ermitteln oder Telekommunikationsverbindungen zu unterbrechen oder zu verhindern. Mit dem neuen PolG 2020 wurde dieser Bereich umfassend in den §§ 52–55 geregelt (s. u. §§ 52 ff.).
e) Recht auf Freizügigkeit (Art. 11 GG)
14
Freizügigkeit bedeutet die Möglichkeit, an jedem Ort innerhalb des Bundesgebietes Aufenthalt und Wohnsitz zu nehmen, und damit das Recht, einen Ortswechsel(auch innerhalb einer Gemeinde) vorzunehmenoder zu unterlassen.
15
Da Art. 73 Abs. 1 Nr. 3 GG dem Bund die ausschließliche Gesetzgebung über die Freizügigkeit vorbehält, ist die Aufnahme des Art. 11 in § 4 verfassungsrechtlichnicht ganz unproblematisch (str.). Auf jeden Fall setzen die Schrankenbestimmungen des Art. 11 Abs. 2 GG dem Gesetzgeber enge Grenzen. Freizügigkeitsbeschränkende Maßnahmen sind z. B. die Einweisungin eine außergemeindliche Wohnung, der sog. Verbringungsgewahrsam, der Wohnungsverweisoder ein Aufenthaltsverbot(vgl. VGH BW, VBlBW 1997, 66, 67; 2005, 138, 140; VG Sigmaringen, VBlBW 1995, 289, 291). Eine Meldeauflagegreift in das Recht auf Freizügigkeit ein, wenn sie auf die Meldung bei der eigenen Polizeidienststelle beschränkt ist (BVerwG, NVwZ 2007, 1439, 1441).
Читать дальше