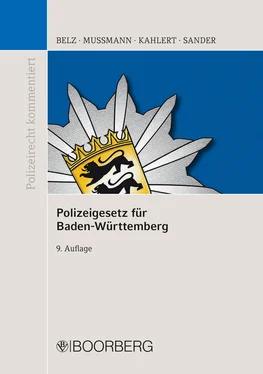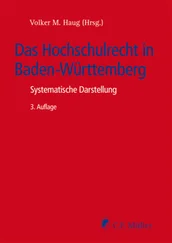24
Art. 6 Abs. 1 GG schützt Eheund Familievor Eingriffen des Staates. Dieses Recht unterliegt verfassungsimmanenten Schranken.
25
Art. 6 Abs. 2 und 3 GG regeln das Elternrecht. Dieses ist – im Unterschied zu anderen Grundrechten – ein pflichtbezogenes Recht, das dem Wohl des Kindes zu dienen hat.
26
Eingeschränkt werden diese Grundrechte z. B. durch einen gegen den gewalttätigen Ehepartner ausgesprochenen Wohnungsverweis(s. u. § 30). Voraussetzung ist allerdings das Bestehen einer rechtsgültigen Ehe. Bei nichtehelichen Lebensgemeinschaften wird der Schutzbereich des Art. 6 Abs. 1 GG nicht berührt.
4. Grundsätzlich nicht durch das Polizeigesetz einschränkbare Grundrechte
a) Würde des Menschen (Art. 1 Abs. 1 GG)
27
Die Menschenwürde verbietetes, den Menschen zum bloßen Objektdes Staates zu machen oder ihn einer Behandlung auszusetzen, die seine Subjektsqualität prinzipiell in Frage stellt. Dementsprechend gebietet § 34 Abs. 3, dass Personen grundsätzlich nur von Personen gleichen Geschlechts oder Ärzten durchsucht werden, verbietet § 40 Abs. 1die Anwendung von Zwang zur Herbeiführung einer Aussage bei Vernehmungen und setzt § 1 DVO PolGMindeststandards bei der Durchführung des Gewahrsams fest. Polizeiliche Maßnahmen, welche die Menschenwürde verletzen, sind zumindest rechtswidrig, wie z. B. die Einweisungvon Obdachlosen in eine menschenunwürdige Unterkunft(vgl. VGH BW, VBlBW 1985, 18; 1993, 304; NJW 1993, 1027; DVBl. 1996, 567, 568) oder die Anwendung von Folter, selbst dann, wenn es um den Schutz der Menschenwürde anderer Personen, z. B. einer entführten Person, geht (h. M.). Zum Recht auf informationelle Selbstbestimmungs. u. Vorbem. §§ 11-16, RN 2. Zur Würde des Menschen als polizeiliches Schutzguts. o. § 1, RN 19.
Da nach h. M. (BVerfGE 30, 173, 194; NJW 1994, 783; VGH BW, VBlBW 2006, 186, 187) auch die Würde Verstorbenerzu beachten ist, stellt sich die Frage, ob die Ausstellung von Plastinatenverstorbener Menschen Art. 1 Abs. 1 GG tangiert und sie deswegen verboten oder mit Auflagen versehen werden kann (s. o. § 1, RN 19).
b) Gleichheitssatz (Art. 3 GG)
28
Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG und die speziellen Gleichheitssätze des Art. 3 Abs. 2 und 3 GG binden die Polizei bei allen Maßnahmen. So darf eine Polizeiverordnungvon mehreren gleichartigen Gefährdungen nicht willkürlich nur eine zum Regelungsgegenstand auswählen (VGH BW, NVwZ 1992, 1105, 1107; 1999, 1016 – sog. Kampfhundeverordnungen). Eine besondere Rolle spielt der allgemeine Gleichheitssatz bei Ermessensentscheidungen(s. o. § 3, RN 32).
c) Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG)
29
Eingriffe, die sich gegen den Inhaltvon Presseerzeugnissen (Bücher, Zeitschriften, Flugblätter, Plakate usw.) richten, sind nurim Rahmen des Landespressegesetzes(vgl. § 1 Abs. 2 LPresseG), nicht aber aufgrund des Polizeigesetzes möglich. Insofern sagt man, ist die Presse „polizeifest“. Ansonsten, z. B. bei der Herstellung und beim Vertrieb, ist die Presse den Gesetzen entworfen, die für jedermann gelten (§ 1 Abs. 5 LPresseG), sodass insofern auch Maßnahmen aufgrund des Polizeigesetzes möglich sind (vgl. auch VwV IM über die Verhaltensgrundsätze zwischen Presse und Polizei vom 8.2.2002 – GABl. S. 220).
Beispiel:Polizeibeamte stellen die Identität eines Pressefotografen fest (§ 27 Abs. 1 Nr. 1), wenn die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass dieser Lichtbilder von Polizeibeamten bei einem Polizeieinsatz in unzulässiger Weise (vgl. §§ 22, 23, 33 KunstUrhG) veröffentlichen werde (VGH BW, VBlBW 1995, 282; 1998, 109).
d) Vereinigungsfreiheit, Koalitionsfreiheit (Art. 9 GG)
30
Das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden (Art. 9 Abs. 1 GG), kann zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung nurnach Maßgabe des Vereinsgesetzeseingeschränkt werden (§ 1 Abs. 2 VereinsG). Vereinigungen können nur dann verbotenwerden, wenn die insoweit abschließendenVoraussetzungen des Art. 9 Abs. 2 GG vorliegen (vgl. §§ 3 ff. VereinsG). Welche Behörden zur Ausführung des Vereinsgesetzes zuständig sind, regelt die gemeinsame Verordnung der Landesregierung und des Innenministeriums über die Zuständigkeiten nach dem Vereinsgesetz.
31
Die Koalitionsfreiheit (Art. 9 Abs. 3 GG) umfasst auch das Streikrecht. Maßnahmen aufgrund des Polizeigesetzes gegen einen Streik sind daher nichtzulässig. Nach h. M. gelten die Schranken des Art. 9 Abs. 2 GG auch für die Koalitionsfreiheit. Arbeitskampfmaßnahmen, die z. B. den Strafgesetzen zuwiderlaufen (Betriebsblockaden, -besetzungen, gewaltsame Behinderung von Arbeitswilligen, „Streiks“ von Beamten) können deshalb eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen, gegen die mit den Mitteln des Polizeigesetzes eingeschritten werden darf (OVG Hamburg, NJW 1983, 605; VGH Kassel, NVwZ 1990, 386).
e) Berufsfreiheit (Art. 12 GG)
32
„Beruf“ist jede erlaubte, auf Dauer angelegte Tätigkeit, die der Schaffung und Erhaltung einer Lebensgrundlage dient. Die Berufsfreiheit, die sowohl die Freiheit der Berufswahl wie auch die Freiheit der Berufsausübung umfasst, unterliegt dem Vorbehalt des Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG, wobei die Zulässigkeit von Eingriffen einer Stufenfolge unterliegt („Dreistufentheorie“; BVerfGE 7, 377). Einschränkungen der Berufs wahlsind nur aufgrund eines speziellen Gesetzes (vgl. z. B. § 1 GewO), nicht aber nach dem Polizeigesetz zulässig. Letzteres kann allerdings Grundlage für Eingriffe in die Berufs ausübungsein, sofern spezielle Rechtsgrundlagen fehlen (BVerwG, NVwZ 2002, 598 – Laserdrom). Dass Art. 12 GG nicht in § 4 genannt ist, steht dem nicht entgegen, weil für dieses Grundrecht wegen seines Regelungsvorbehalts nicht das Zitiergebot des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG gilt ( s. o. RN 1).
(1) Kommen für die Wahrnehmung einer polizeilichen Aufgabe mehrere Maßnahmen in Betracht, so hat die Polizei die Maßnahme zu treffen, die den Einzelnen und die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt.
(2) Durch eine polizeiliche Maßnahme darf kein Nachteil herbeigeführt werden, der erkennbar außer Verhältnis zu dem beabsichtigten Erfolg steht.
Literatur: Erbel, Die Unmöglichkeit von Verwaltungsakten, 1972; Grupp, Das Angebot des anderen Mittels, VerwArch Bd. 68 (1978) 125; Heintzen, Konkretisierungen des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, DVBl. 2004, 721; Ossenbühl, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (Übermaßverbot) in der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte, Jura 1997, 617 Michael, Grundfälle zur Verhältnismäßigkeit, JuS 2001, 654 u. 764; Voßkuhle, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, JuS 2007, 429.
Inhaltsübersicht
1. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
2. Die Komponenten des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit
Читать дальше