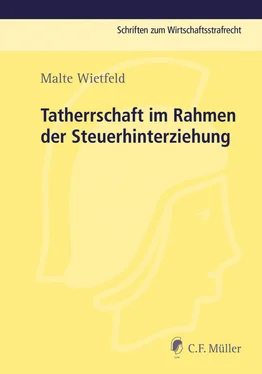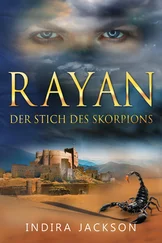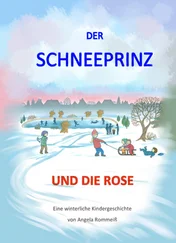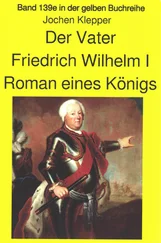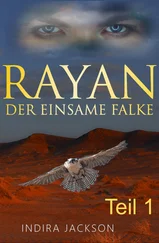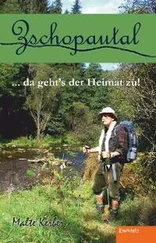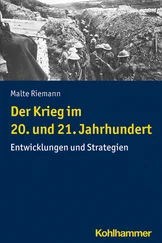D. Fazit zu den Kernthesen der Tatherrschaftslehre im Sinne Roxins
15
Zusammengefasst lauten die Kernthesen der Tatherrschaftslehre von Roxin damit:
Die zentrale Gestalt der Tatbestandsverwirklichung und damit Täter ist derjenige, der das tatbestandsmäßige Geschehen bis zum Erfolg beherrscht. Teilnehmer dagegen nehmen zwar auch Einfluss auf das Geschehen, haben aber keine beherrschende oder mitgestaltende Stellung. Unmittelbaren-, mittelbaren- und Mittätern kommt dabei jeweils eine spezifische Art der Tatherrschaft zu. Anhand eines beschreibenden Verfahrens ist zu ermitteln, ob der unmittelbare Täter Handlungsherrschaft, der mittelbare Täter Willensherrschaft und der Mittäter funktionelle Tatherrschaft im Rahmen der Deliktsverwirklichung gehabt hat. Dabei muss aber beachtet werden, dass der Tatherrschaftsgedanke nur im Bereich von Herrschaftsdelikten nicht dagegen im Bereich von Pflichtdelikten und eigenhändigen Delikten anwendbar ist.
Teil 3 Neueste Kritik an der Tatherrschaftslehre
Inhaltsverzeichnis
A. Kritik an dem Kriterium der Handlungsherrschaft als Tatherrschaftsmerkmal des unmittelbaren Täters
B. Willensherrschaft als Tatherrschaftsmerkmal des mittelbaren Täters
C. Die funktionelle Tatherrschaft als Tatherrschaftsmerkmal des Mittäters
D. Zwischenfazit zur neuesten Kritik an der Tatherrschaftslehre
E. Fehlende normative Begründung des Tatherrschaftsbegriffs
F. Kritik an der Herleitung von Mittäterschaft im Rahmen der Tatherrschaftslehre
G. Verlust des objektiven Tatbezuges der Tatherrschaftslehre
H. Zwischenfazit zur neuesten Kritik an der Tatherrschaftslehre
J. Zirkelschluss der Tatherrschaftslehre
K. Zwischenfazit zur neuesten Kritik an der Tatherrschaftslehre
L. Fazit zur neuesten Kritik an der Tatherrschaftslehre
16
Trotz ihrer weitgehenden Etablierung in der Wissenschaft ist es der Tatherrschaftslehre zu keinem Zeitpunkt gelungen, Kritik vollständig zu überwinden. Unter den Kritikern der Tatherrschaftslehre befanden sich auch stets solche, die nicht nur einzelne Aspekte dieser Lehre kritisierten, sondern der Tatherrschaftslehre insgesamt kritisch gegenüberstanden. Nur beispielhaft sei etwa auf Freund [1] hingewiesen: „ Solange unklar bleibt, wie die zu beherrschende Tat genau beschaffen sein muss, um eine Verantwortlichkeit als Täter oder Teilnehmer dieser Tat zu begründen, ist der Herrschaftsbegriff ein „Zauberhut“, aus dem praktisch jedes beliebige Ergebnis herausgeholt werden kann. Ist dagegen geklärt, wie die Tat, wegen derer bestraft werden soll, näherhin beschaffen ist, entbehrt ein zusätzliches Herrschaftserfordernis speziell für die Tatbestände, die täterschaftliches Verhalten erfassen, der Berechtigung. “
Nicht zu bestreiten ist gleichwohl, dass derart grundlegende Kritik an der Tatherrschaftslehre gegen Ende des zwanzigsten Jahrhunderts eher vereinzelt geäußert wurde.[2] In jüngerer Zeit erschienen nun jedoch in vermehrtem Maße Abhandlungen, die der Tatherrschaftslehre bereits in ihren Grundthesen widersprechen und auf der Basis einer kritischen Analyse die Lehre von der Tatherrschaft als Täterlehre insgesamt ablehnen.[3] Für die vorliegende Untersuchung wirft dies die Frage nach dem Einfluss dieser Kritik auf die Anwendung der Tatherrschaftslehre im Rahmen der Steuerhinterziehung auf. Vor diesem Hintergrund sollen im Folgenden diejenigen Einwände gegen die Tatherrschaftslehre herausgearbeitet werden, die sich unter Umständen auf das Steuerstrafrecht übertragen lassen und dort möglicherweise einer Anwendung der Tatherrschaftslehre auf die Steuerhinterziehung im Wege stehen könnten.
[1]
Freund Strafrecht Allgemeiner Teil (1998), § 10 Rn. 47.
[2]
Eine umfassende Übersicht mit Kritik an und Gegenentwürfen zu seiner Lehre findet sich bei Roxin selbst, Täterschaft und Tatherrschaft, S. 659 ff.
[3]
Zu nennen sind hier insbesondere die Arbeiten von Marlie Unrecht und Beteiligung (2009), Haas Die Theorie der Tatherrschaft und ihre Grundlagen (2008) und Rotsch „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft (2009).
A. Kritik an dem Kriterium der Handlungsherrschaft als Tatherrschaftsmerkmal des unmittelbaren Täters
17
Zunächst wird kritisiert, das Kriterium der Handlungsherrschaft sei ungeeignet, um unmittelbare Täterschaft hinreichend sicher bestimmen zu können. Die Handlungsherrschaft ist der Grundtypus der Tatherrschaftslehre.[1] Wer eine Tatbestandshandlung eigenhändig vornimmt, soll nach Auffassung Roxins unmittelbarer Täter kraft Handlungsherrschaft sein.[2] Die Richtigkeit dieser Grundthese ist in einfach gelagerten Fällen scheinbar evident. Wer einem anderen einen Faustschlag versetzt, ist Täter einer Körperverletzung, und wer eine Steuererklärung wissentlich falsch ausfüllt und diese beim Finanzamt einreicht, ist Täter einer Steuerhinterziehung.[3] Jenseits dieser einfach gelagerten Fälle ist die Zuordnung hingegen schwieriger und es ergeben sich nachhaltige Abgrenzungsschwierigkeiten. Wer hat beispielsweise Handlungsherrschaft, wenn A den B anschießt, diesen dadurch in der Nähe der Hauptschlagader lebensgefährlich verletzt und Arzt C bei dem Versuch, B das Leben zu retten, die Hauptschlagader vollständig durchtrennt und so letztlich den Tod des B verursacht?[4] Dies ist der Ansatzpunkt der Kritik an dem Kriterium der Handlungsherrschaft, an deren Ende das Ergebnis steht, das Kriterium der Handlungsherrschaft sei aufgrund seiner Unbestimmtheit gänzlich ungeeignet, die Täterschaft des unmittelbaren Täters zu bestimmen.[5] Anknüpfungspunkt dieser These ist der Begriff der Tatbestandshandlung.[6] Bei einer Vielzahl von Straftatbeständen sei es aufgrund ihrer Tatbestandsstruktur nicht möglich, abstrakt eine konkrete Handlung zu definieren, die zwingend zu einer täterschaftlichen Verantwortung führe. Vielmehr bestehe bei derartigen Delikten das tatbestandliche Verhalten allein in der – irgendwie gearteten – Verursachung des tatbestandlichen Erfolges. Solche Tatbestände müssten deshalb als reine Verursachungsdelikte charakterisiert werden.[7] Bei Verursachungsdelikten – genannt werden beispielhaft etwa die Körperverletzung und der Totschlag[8]– seien verschiedenste Verhaltensweisen denkbar, die sich abstrakt dazu eigneten, den tatbestandlichen Erfolg herbeizuführen. Es komme im Rahmen solcher Delikte daher lediglich auf die Verursachung des tatbestandlichen Erfolges, nicht dagegen auf die Art und Weise der Herbeiführung dieses Erfolges an.[9] Dieser Umstand stehe einer Anwendung des Kriteriums der Handlungsherrschaft als der eigenhändigen Vornahme der Tatbestandshandlung zwingend im Wege. Dies verdeutliche sich, wenn man sich vergegenwärtige, dass die Äquivalenztheorie von der Gleichwertigkeit aller Bedingungen ausgehe.[10] Auf der Basis der Äquivalenztheorie verursachten Teilnehmer den Erfolg im gleichen Maße wie Täter, denn es gelte die Lehre von der Gleichwertigkeit aller Bedingungen. Wenn somit im Rahmen eines Verursachungsdeliktes nicht geklärt sei, worin genau die Tatbestandshandlung bestehe, die ein Beteiligter eigenhändig ausgeführt haben müsse, um unmittelbarer Täter zu sein, sei die These, Täter kraft Handlungsherrschaft sei derjenige, der die Tatbestandshandlung eigenhändig vorgenommen habe, ein untaugliches Kriterium zur Bestimmung von Täterschaft, weil eben nicht klar sei, welcher der verschiedenen denkbaren Verursachungsbeiträge die Tatbestandshandlung im Sinne der Handlungsherrschaft sei.[11] Aufgrund dieses Befundes wird vertreten, die Definition von Handlungsherrschaft bedürfe der Konkretisierung, um klar festlegen zu können, welches Verhalten[12] die Tatbestandshandlung im Sinne der Handlungsherrschaft sei und deshalb zu einer täterschaftlichen Verantwortung führe.[13] Am Ende der diesbezüglichen Untersuchung steht jedoch die Erkenntnis, dass keine irgendwie geartete Konkretisierung in Betracht komme, die eine sichere Abgrenzung von Täter- und Teilnehmerverhalten ermögliche, was zu einer generellen Untauglichkeit des Kriteriums der Handlungsherrschaft führe.[14]
Читать дальше