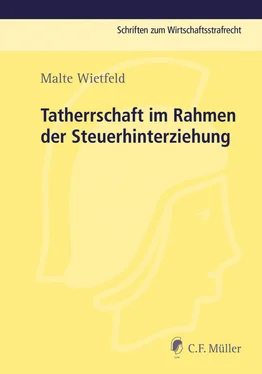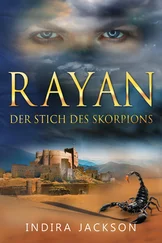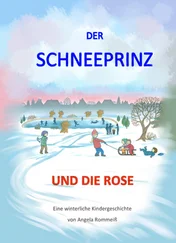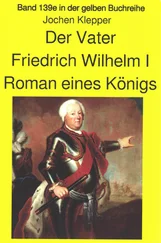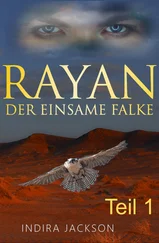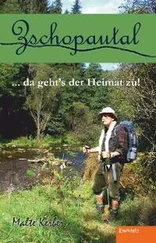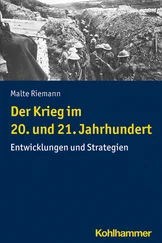[1]
Das gelte nicht für Pflichtdelikte und eigenhändige Delikte.
[2]
Roxin Täterschaft und Tatherrschaft, S. 123.
B. Beschreibung der Zentralgestalt des handlungsmäßigen Geschehens bei Herrschaftsdelikten
7
Auf diesen methodischen Grundlagen entfaltet Roxin sein beschreibendes Verfahren zur Ermittlung von Täterschaft bei Herrschaftsdelikten. Entsprechend der heute in § 25 StGB normierten Dreiteilung unterscheidet er dabei drei verschiedene Täterschaftsformen: den unmittelbaren Täter (§ 25 Abs. 1 Alt. 1 StGB), den mittelbaren Täter (§ 25 Abs. 1 Alt. 2 StGB) und den Mittäter (§ 25 Abs. 2 StGB). Allen drei Täterschaftsformen komme dabei eine spezifische Art der Tatherrschaft zu: der unmittelbare Täter zeichne sich durch Handlungsherrschaft, der mittelbare Täter durch Willensherrschaft und der Mittäter durch funktionelle Tatherrschaft aus.[1]
[1]
Roxin Strafrecht Allgemeiner Teil, § 25 Rn. 28.
Teil 2 Grundzüge der Tatherrschaftslehre nach Roxin› B. Beschreibung der Zentralgestalt des handlungsmäßigen Geschehens bei Herrschaftsdelikten› I. Handlungsherrschaft bei unmittelbarer Täterschaft
I. Handlungsherrschaft bei unmittelbarer Täterschaft
8
Die Handlungsherrschaft ist nach Roxin das Tatherrschaftsmerkmal des unmittelbaren Täters (§ 25 Abs. 1 Alt. 1 StGB). Als unmittelbaren Täter kraft Handlungsherrschaft bezeichnet Roxin denjenigen, „der – sei es allein, sei es unter Beteiligung mehrerer – den gesamten Tatbestand durch eigenkörperliche Aktivität (also i.d.R. mit eigener Hand) verwirklicht.“[1] Die eigenhändige Tatausführungsei die stärkste denkbare Form der Tatbeherrschung. Handlungsherrschaft werde hier durch die eigenhändige Vornahme der tatbestandsentsprechenden Handlung vermittelt.[2] In Abkehr vom „Badewannen“-[3] und vom „Stachynskijfall“[4] sei es deshalb ausgeschlossen, Täterschaft allein aus subjektiven Momenten herzuleiten und daher eine Person, die das tatbestandsmäßige Geschehen zwar selbst vorgenommen, aber kein eigenes Tatinteresse gehabt habe, nicht als Täterin einzustufen.[5] Diese Ausprägung der Zentralgestalt finde sich heute auch im Wortlaut des § 25 Abs. 1 Alt. 1 StGB wieder, der denjenigen als Täter ansehe, der die Tat „selbst…begeht“.[6]
[1]
Roxin Strafrecht Allgemeiner Teil, § 25 Rn. 38.
[2]
Roxin Strafrecht Allgemeiner Teil, § 25 Rn. 38.
[3]
RGH v. 19.2.1940, 3 D 69/40, RGHSt 74, 84 ff.
[4]
BGH v. 19.10.1962, 9 StE 4/62, BGHSt 18, 87 ff.
[5]
Roxin Strafrecht Allgemeiner Teil, § 25 Rn. 39 f.
[6]
Roxin Strafrecht Allgemeiner Teil, § 25 Rn. 38.
Teil 2 Grundzüge der Tatherrschaftslehre nach Roxin› B. Beschreibung der Zentralgestalt des handlungsmäßigen Geschehens bei Herrschaftsdelikten› II. Willensherrschaft bei mittelbarer Täterschaft
II. Willensherrschaft bei mittelbarer Täterschaft
9
In § 25 Abs. 1 Alt. 2 StGB stellt der Gesetzgeber klar, dass Täter auch eine Person sein kann, die den Taterfolg nicht eigenhändig, sondern durch einen anderen verursacht hat. Diese Form der Täterschaft wird bekanntlich als mittelbare Täterschaft bezeichnet. Spezifische Ausprägung von Tatherrschaft bei der mittelbaren Täterschaft ist nach Ansicht von Roxin die sogenannte Willensherrschaft.[1] Dem Hintermann soll dabei eine willensbeherrschende Machtposition über den unmittelbar Ausführenden zukommen. Der Wille des unmittelbar Ausführenden könne in diesem Zusammenhang auf drei unterschiedliche Arten beherrscht werden. Demgemäß unterteile sich die Willensherrschaft in Willensherrschaft kraft Nötigung (Nötigungsherrschaft), Willensherrschaft kraft Irrtums (Irrtumsherrschaft) und Willensherrschaft kraft der Beherrschung eines organisatorischen Machtapparates (Organisationsherrschaft).[2]
10
Grundlage der Nötigungsherrschaft sei das sogenannte Verantwortungsprinzip. In Fällen der Willensherrschaft kraft Nötigung übe der Hintermann auf den unmittelbar Tatausführenden einen derartigen Druck aus, dass dieser von seiner strafrechtlichen Verantwortung gemäß § 35 StGB befreit werde. Die Befreiung des unmittelbar Tatausführenden von strafrechtlicher Verantwortung habe dabei automatisch die Belastung des druckausübenden Hintermannes mit täterschaftlicher Verantwortung zur Folge – dies sei Ausfluss des „Verantwortungsprinzips“ und vermittele dem Hintermann Tatherrschaft.[3]
11
Strukturell von der Nötigungsherrschaft zu unterscheiden sei die sogenannte Willensherrschaft kraft Irrtums. Während bei der Nötigungsherrschaft die Verhaltenszurechnung über eine Entbindung von strafrechtlicher Verantwortung aufgrund ausgeübten Drucks geschehe, soll im Bereich der Willensherrschaft kraft Irrtums nicht Zwang sondern ein Mehr an Wissen der entscheidende Faktor für Verhaltenszurechnung und damit die Tatherrschaft sein.[4] Der Tatherr habe hier aufgrund seines Wissensvorsprungs die Möglichkeit einer „gestaltenden Überdetermination“, weil er durch sein Mehr an Wissen die Möglichkeit habe, den Tatverlauf nach seinem Willen zu gestalten.[5] Irrtumsherrschaft sei dabei in vier verschiedenen Varianten denkbar. Erstens könne Irrtumsherrschaft vorliegen, wenn der Hintermann den Tatausführenden in einen vorsatzausschließenden Tatbestandsirrtum versetze.[6] Zweitens könne Irrtumsherrschaft vorliegen, wenn der Hintermann sich einen Verbotsirrtum des unmittelbar Tatausführenden zunutze mache.[7] Drittens könne Irrtumsherrschaft vorliegen, wenn ein Hintermann den unmittelbar Tatausführenden derart täusche, dass dieser über die Voraussetzungen eines entschuldigenden Notstandes irre.[8] Schließlich hält Roxin Irrtumsherrschaft viertens ausnahmsweise dann für denkbar, wenn der unmittelbar Tatausführende zwar volldeliktisch handele, aber gleichwohl einer Willensbeeinflussung durch einen Hintermann ausgesetzt sei, „die sich zwar nicht auf die juristische Verantwortlichkeit des unmittelbar Handelnden, aber auch nicht nur auf dessen Motive, sondern auf die Tat als solche beziehen und sie zu einer anderen machen, die dem Hintermann zugerechnet werden kann.“[9] Denkbar seien in diesem Zusammenhang Täuschungen über die Unrechtshöhe, über qualifikationsbegründende Umstände oder die Identität des Opfers.[10]
3. Organisationsherrschaft
12
Dritte und letzte Form der Willensherrschaft ist nach der Lehre Roxins die Tatherrschaft kraft der Beherrschung eines organisatorischen Machtapparates – kurz Organisationsherrschaft genannt.[11]
Organisationsherrschaft sei letztlich eine Sonderform des Täters hinter dem volldeliktisch handelnden Täter. Grundgedanke der Organisationsherrschaft ist, dass es neben der Nötigungsherrschaft und der Irrtumsherrschaft eine weitere Fallgruppe gibt, in der der Hintermann – ohne zu zwingen oder zu täuschen – einen derartigen Einfluss auf den unmittelbar Ausführenden ausübt, dass dieser Einfluss die Qualität von Tatherrschaft hat und damit täterschaftsbegründend ist.[12] Zu denken sei hierbei an die Beherrschung eines rechtsgelösten Machtapparates, der so hierarchisch organisiert sei, dass die Befehlshaber dieses Machtapparates allein aufgrund ihrer übergeordneten Stellung in dieser Organisation Straftaten verursachen könnten. Diese Straftaten würden dadurch begangen, dass ein entsprechender Befehl gegeben werde und sich die Machthaber – auch ohne Zwang oder Täuschung – sicher sein könnten, dass ihr Befehl von irgendeinem der Befehlsunterworfenen ausgeführt werde. Tatherrschaftsbegründend sei bei diesen Straftaten letztlich die sogenannte „Fungibilität“, also die Auswechselbarkeit des Tatausführenden. Dieser sei schlicht ein auswechselbares und jederzeit ersetzbares Instrument, wohingegen die wahre Tatbeherrschung beim Hintermann liege.[13] Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Roxin das Vorliegen von Organisationsherrschaft ursprünglich von den folgenden Voraussetzungen abhängig gemacht hat: Zunächst müsse ein organisatorischer Machtapparat vorliegen, der sich durch eine hierarchische Gliederung kennzeichne. Dieser Machtapparat müsse insgesamt rechtsgelöst sein. Im Rahmen dieses rechtsgelösten Machtapparates konstituiere sich die Tatherrschaft des Hintermannes dann durch die jederzeitige Austauschbarkeit, also die Fungibilität des unmittelbar Handelnden, die dem Hintermann den Taterfolg garantiere.[14]
Читать дальше