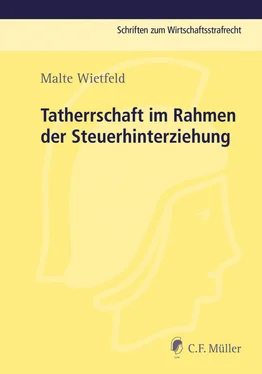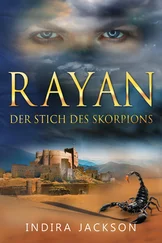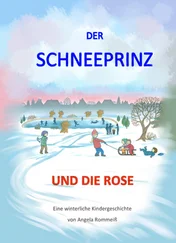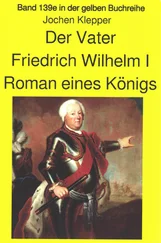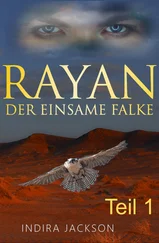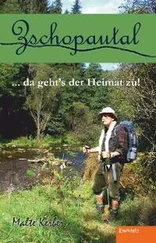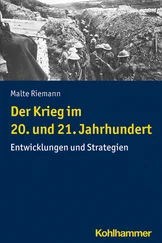Die besondere Bedeutung des Kriteriums der Tatherrschaft im Zusammenhang mit derartigen Fragen zeigt sich an dem Umstand, dass sich Rechtsprechung und Wissenschaft bei der Bestimmung von Täterschaft sowie der Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme zwischenzeitlich ein gutes Stück aufeinander zu bewegt haben. Die Rechtsprechung trägt ihrem ursprünglich rein subjektiv geprägten Ansatz heute durch eine Bestimmung des Täterwillens anhand einer wertenden Gesamtschau verschiedener subjektiver und objektiver Kriterien Rechnung. Die Ergebnisse dieser wertenden Gesamtschau hängen dabei „unter anderem von dem Grad des eigenen Interesses am Taterfolg, dem Umfang der Tatbeteiligung sowie der Tatherrschaft oder wenigstens dem Willen zur Tatherrschaft ab“.[6] Insoweit wird von einer „normativen Kombinationstheorie“ gesprochen.[7] Vor diesem Hintergrund kann durchaus von einer gewissen Hinwendung der Rechtsprechung zur Tatherrschaftslehre gesprochen werden.[8]
[1]
S. www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/deutsche-bank-fitschen-wird-trotz-ermittlungen-nicht-zuruecktreten-a-872598.html(letzter Aufruf: 3.1.2014).
[2]
Siehe etwa Joecks F/G/J Steuerstrafrecht § 369 Rn. 73; Klein/Jäger AO, § 370 Rn. 212; MünchKommStGB/ Schmitz/Wulf § 370 AO, Rn. 381; Kummer W/J HB des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts, 20. Kap. Rn. 22; Ransiek Kohlmann Steuerstrafrecht, § 370 AO Rn. 98 f.; Hadamitzky/Senge E/K Strafrechtliche Nebengesetze, § 370 AO Rn. 80, Sieja DStR 2012, 991 (992).
[3]
Siehe etwa BGH v. 9.4.2013, 1 StR 586/12, DStR 2013, 1177 (1179); v. 7.11.2006, 5 StR 164/06, NStZ-RR 2007, 345; v. 30.6.2005, 5 StR 12/05, NStZ 2006, 44 f. (45); v. 30.10.2003, 5 StR 274/03, NStZ-RR 2004, 56 f. (56); v. 15.1.1991, 5 StR 492/90, BGHSt. 37, 289 (291).
[4]
RGH v. 19.2.1940, III D 69/40, RGHSt 74, 84 ff.; siehe dazu auch Johannsen Die Entwicklung der Teilnahmelehre in der Rechtsprechung, S. 76 ff.
[5]
Siehe dazu Ransiek Kohlmann Steuerstrafrecht, § 370 AO Rn. 107.2.
[6]
Siehe etwa BGH v. 9.4.2013, 1 StR 586/12, DStR 2013, 1177 (1179); v. 7.11.2006, 5 StR 164/06, NStZ-RR 2007, 345; v. 30.6.2005, 5 StR 12/05, NStZ 2006, 44 f. (45); v. 30.10.2003, 5 StR 274/03, NStZ-RR 2004, 56 f. (56); v. 15.1.1991, 5 StR 492/90, BGHSt. 37, 289 (291).
[7]
Siehe nur Roxin Strafrecht Allgemeiner Teil, § 25 Rn. 22.
[8]
Rotsch NStZ 2005, 13 (16 f.).
B. Das Tatherrschaftskriterium nach Roxin als Ausgangspunkt der Überlegungen
2
Mit den vorstehenden Ausführungen ist der Rahmen für die vorliegende Arbeit abgesteckt. Es geht mithin um eine Analyse des Kriteriums der Tatherrschaft im Rahmen der Steuerhinterziehung. Hieraus leitet sich zwangsläufig die Folgefrage ab, wie genau „die Tatherrschaft“ zu definieren ist. Aus dem Kriterium der Tatherrschaft haben sich eine Reihe von Theorien und Meinungen herausgebildet, die zwar sämtlich die Herrschaft über das Geschehen als gemeinsame Basis für die dogmatische Herleitung von Täterschaft, sowie die Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme haben, sich in ihrer genauen Ausgestaltung jedoch – zum Teil erheblich – voneinander unterscheiden. Nur beispielhaft[1] erwähnt seien hier etwa die Theorie von der „funktional-sozialen“ Tatherrschaft[2], sowie die Theorie der „objektiven“ Tatherrschaft[3]. Nach der funktional-sozialen Tatherrschaft kommt es für die Bestimmung von Täterschaft stets auf eine wertende Betrachtung des Geschehens an. Unabhängig von einem bestimmten real-körperlichen Verhalten gehe es stets um die Frage, wem der tatbestandsmäßige Erfolg als sein Werk zuzurechnen sei. Dies gelte gleichermaßen für unmittelbare-, mittelbare- und Mittäterschaft.[4] Anders bei der Theorie von der objektiven Tatherrschaft. Diese Theorie tritt umfassend von einem subjektiv geprägten Täterbegriff ab und verlagert sich stattdessen vollständig ins Objektive. Täter und damit Tatherr könne nur eine Person sein, die selbst – durch eigenes Verhalten – einen Teil des objektiven Tatbestands der jeweils in Rede stehenden Strafnorm verwirklicht habe.[5] Dies habe insbesondere Auswirkungen auf die Mittäterschaft. Jeder Mittäter müsse dort durch eigenes Verhalten einen Teil des objektiven Tatbestands verwirklichen, um Tatherrschaft zu haben und deshalb Mittäter zu sein.[6] Allein diese kurzen Schilderungen verdeutlichen den weiten Rahmen, in dem sich das Kriterium der Tatherrschaft heute bewegt.
Vor dem Hintergrund, dass der Frage nach Tatherrschaft bei der Steuerhinterziehung – soweit ersichtlich – bislang noch keine umfassende Untersuchung gewidmet wurde, erscheint es sinnvoll, mit der Tatherrschaftslehre im von Roxin verstandenen Sinne nur eine der verschiedenen denkbaren Varianten dieser Täterlehre in den Fokus zu nehmen.[7] Hintergrund ist, dass Roxin zwar nicht als Begründer, dagegen jedoch durchaus als derjenige bezeichnet werden kann, der die Tatherrschaftslehre als Erster umfassend ausgearbeitet sowie strukturiert hat und dessen Verständnis von Tatherrschaft damit heute als Basis der Tatherrschaftslehre bezeichnet werden kann.[8]
Hierzu sollen zunächst noch einmal kurz die wesentlichen Grundideen der Tatherrschaftslehre im von Roxin verstandenen Sinne ins Bewusstsein gerufen werden. Sodann schließt sich als weitere Vorarbeit eine Auswertung der in jüngster Zeit vermehrt laut gewordenen Grundsatzkritik an der Tatherrschaftslehre an. Ziel ist es, auf diese Weise ein Fundament zu schaffen, auf dessen Grundlage anschließend eine Untersuchung von Tatherrschaft im Rahmen der Steuerhinterziehung erfolgen kann, die sich zum einen an den Grundlagen dieser Täterlehre orientieren und zum anderen mit der grundsätzlichen Kritik hieran auseinandersetzen kann.
[1]
Eine umfassende Darstellung verschiedener Varianten der Tatherrschaftslehre findet sich bei Schild Tatherrschaftslehren, insbesondere S. 33 ff.
[2]
Otto Grundkurs Strafrecht, § 21 Rn. 7 f; 26; siehe dazu auch Schild Tatherrschaftslehren, S. 63 f.
[3]
Luzón Peña/Díaz y García Conlledo FS Roxin, S. 575 ff; siehe dazu auch Schild Taherrschaftslehren, S. 74 ff.
[4]
Otto Grundkurs Strafrecht, § 21 Rn. 52 ff., 68 ff., 93 ff.
[5]
Luzón Peña/Díaz y García Conlledo FS Roxin, S. 575 (589 f.)
[6]
Luzón Peña/Díaz y García Conlledo FS Roxin, S. 575 (595 f.)
[7]
Soweit im Rahmen der nachfolgenden Untersuchung vereinzelt auf weitere Tatherrschaftstheorien abgestellt wird, so erfolgt dort jeweils ein gesonderter Hinweis.
[8]
Haas Die Theorie der Tatherrschaft und ihre Grundlagen, S. 8.
Teil 2 Grundzüge der Tatherrschaftslehre nach Roxin
Inhaltsverzeichnis
A. Methodische Grundlagen
B. Beschreibung der Zentralgestalt des handlungsmäßigen Geschehens bei Herrschaftsdelikten
C. Von der Tatherrschaftslehre nicht erfasste Deliktsgruppen
D. Fazit zu den Kernthesen der Tatherrschaftslehre im Sinne Roxins
3
Roxin hat seine Tatherrschaftslehre erstmals im Jahr 1963[1] umfassend ausgearbeitet. Seitdem hat er sie ständig fortentwickelt und zuletzt im Jahr 2006[2] umfassend auf einen neuen Stand gebracht. Die folgenden Ausführungen orientieren sich an diesem Stand seiner Lehre.
[1]
Roxin Täterschaft und Tatherrschaft, 1. Auflage 1963.
[2]
Roxin Täterschaft und Tatherrschaft, 8. Auflage 2006.
A. Methodische Grundlagen
Teil 2 Grundzüge der Tatherrschaftslehre nach Roxin› A. Methodische Grundlagen› I. Täterbegriff als Synthese aus ontologischem und teleologischem Strafrechtsdenken
Читать дальше