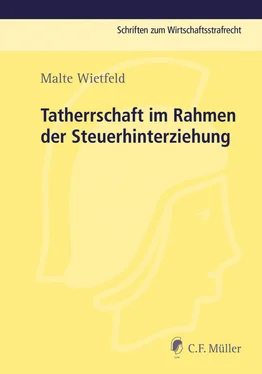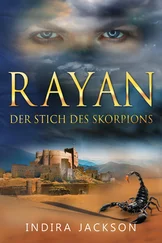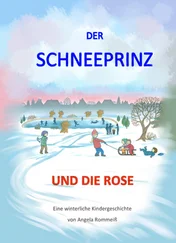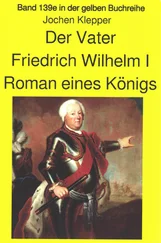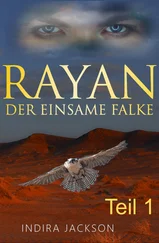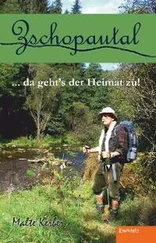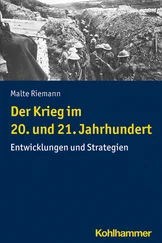I. Täterbegriff als Synthese aus ontologischem und teleologischem Strafrechtsdenken
4
Der Tatherrschaftslehre Roxins liegt eine Synthese aus ontologischem und teleologischem Strafrechtsdenken zu Grunde.[1] Ontologie ist die „Lehre vom Sein“.[2] Sie gliedert sich in die grundsätzliche Frage danach, was das Sein ausmacht und in die Frage danach, was, beziehungsweise „welche allgemeinsten Arten von Seiendem“ als „Inventar unserer Welt“ existieren.[3] Es geht der Ontologie um die Erforschung vorgegebener Sachzusammenhänge.[4] Übertragen auf die Täterlehre bedeutet dies, dass ein ontologisches Täterverständnis versuchen muss, den Täterbegriff anhand rechtlich vorgegebener und im Bewusstsein des Menschen existierender Phänomene zu erklären.[5]
Roxin verbindet ein derartiges ontologisches Denken mit teleologischen Erwägungen. Teleologie bezeichnet bekanntlich die Lehre von den Zwecken oder Zielen. Im Bereich des menschlichen Handelns untersucht die Teleologie also den durch das menschliche Verhalten verfolgten Zweck.[6] Im rechtswissenschaftlichen Zusammenhang bedeutet das eine am Gesetzeszweck orientierte Denkweise.[7] Ein teleologisches Täterverständnis bestimmt Täterschaft daher anhand einer wertenden Betrachtung des Tatverhaltens.[8]
Einer derartigen Verbindung von ontologischem und teleologischem Denken bedarf es nach Auffassung Roxins deshalb, weil vorgegebene Bedeutungsinhalte und sinnstiftende Wertsetzungen einander stets gegenseitig beeinflussten. Dies führe zu einer fortwährenden Wechselwirkung.[9] Aufgrund dieser Wechselwirkung könne Täterschaft weder einseitig ontologisch noch einseitig teleologisch, sondern nur durch eine Verbindung beider Denkansätze bestimmt werden.[10]
[1]
Roxin Täterschaft und Tatherrschaft, S. 19 ff., 25.
[2]
Kuhlmann Enzyklopädie Philosophie, S. 1856; siehe zur Funktion der Ontologie in der Rechtswissenschaft Kaufmann Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, S. 11 f.
[3]
Kuhlmann Enzyklopädie Philosophie, S. 1857.
[4]
Roxin Täterschaft und Tatherrschaft, S. 15.
[5]
Roxin Täterschaft und Tatherrschaft, S. 13 ff.
[6]
Hampe/Bschir Enzyklopädie Philosophie, S. 2721.
[7]
Roxin Täterschaft und Tatherrschaft, S. 13.
[8]
Roxin Täterschaft und Tatherrschaft, S. 7 ff.
[9]
Roxin Täterschaft und Tatherrschaft, S. 25.
[10]
Roxin Täterschaft und Tatherrschaft, S. 19 ff.
Teil 2 Grundzüge der Tatherrschaftslehre nach Roxin› A. Methodische Grundlagen› II. Begriff der Zentralgestalt des handlungsmäßigen Geschehens
II. Begriff der Zentralgestalt des handlungsmäßigen Geschehens
5
Aus dieser Verbindung von ontologischem und teleologischem Denken leitet Roxin ein übergeordnetes Leitprinzip von Täterschaft ab. Danach sei der Täter die „Zentralgestalt des handlungsmäßigen Geschehens.“[1] Der Begriff der „Zentralgestalt“ soll dabei sowohl einer teleologischen als auch einer ontologischen Interpretation zugänglich sein. So könne der Gesetzgeber bei einer wertenden, also teleologischen Betrachtung seines Täterbegriffes nur so verstanden werden, dass er den Tatausführenden „als Mittelpunkt und Schlüsselfigur des Deliktsvorgangs“ verstanden wissen wolle. Bei einer auf vorrechtliche Sinnzusammenhänge abstellenden, also ontologischen Betrachtung beschreibe der Begriff der „Zentralgestalt“ dagegen eine plastische und im Gemeinbewusstsein lebende Vorstellung dessen, was einen Täter ausmache.[2] Es dürfe jedoch nicht verkannt werden, dass dieses Leitprinzip allein noch nichts darüber aussage, durch welche inhaltlichen Kriterien die Zentralgestalt, also der Täter im Einzelfall, zu bestimmen sei.[3] Es handele sich daher gerade nicht um eine Definition, sondern lediglich um eine plastische Umschreibung von Täterschaft, aus der erst abgeleitet werden müsse, was in der konkreten Situation den Täter ausmache.[4] Für diese Ableitung müsse der Tatherrschaftsgedanke herangezogen werden. Nur dieser liefere zutreffende Ergebnisse bei der Bestimmung von Täterschaft und sorge für eine adäquate Harmonisierung der Versuche, Täterschaft ausschließlich subjektiv oder ausschließlich objektiv bestimmen zu wollen.[5]
Unter Heranziehung des Tatherrschaftsgedankens sagt Roxin auf dieser Grundlage, „dass Zentralgestalt des Deliktsvorgangs ist, wer das zur Deliktsverwirklichung führende Geschehen beherrscht, während Teilnehmer auf das Geschehen zwar ebenfalls Einfluss nehmen, seine Ausführung aber nicht maßgeblich gestalten“.[6] Hierbei sei zu beachten, dass der Begriff der Tatherrschaft als „offener“ Begriff interpretiert werden müsse.[7]
Ein offener Täterbegriff habe den Vorteil, sich wechselnden Fallgestaltungen anpassen aber gleichzeitig auch generalisierende Beurteilungen zulassen zu können.[8] Abzulehnen sei es dagegen, Tatherrschaft als unbestimmten oder fixierten Begriff zu interpretieren. Ein unbestimmter Begriff gebe der richterlichen Würdigung zu wenige Vorgaben und billige ihr damit eine zu große Machtfülle zu.[9] Ein fixierter Begriff sei dagegen unter anderem deswegen abzulehnen, weil eine begriffliche Fixierung zwangsläufig eine Abstraktion notwendig mache, um alle denkbaren Einzelfälle erfassen zu können. Eine derartige Abstraktion würde aber automatisch zu Lasten einer – gleichwohl notwendigen – Realitätsnähe des Täterbegriffes gehen.[10] Demgegenüber könne ein offener Täterbegriff für sich in Anspruch nehmen, durch ein beschreibendes Verfahren zur Ermittlung von Täterschaft die vorgenannten Mängel zu vermeiden.
Schließlich gelte zusätzlich Folgendes: Bei Delikten, bei denen Täterschaft aus der Herrschaft über das tatbestandsmäßige Geschehen abgeleitet werden könne, müsse von sogenannten „Herrschaftsdelikten“ gesprochen werden. Neben Herrschaftsdelikten seien jedoch weitere Deliktstypen denkbar, bei denen sich die Täterschaft gerade nicht aus der Beherrschung des tatbestandsmäßigen Geschehens ergebe. Für diese Delikte sei der Gedanke der Tatherrschaft daher nicht heranzuziehen. Bei diesen Deliktstypen handele es sich um sogenannte Pflicht- und eigenhändige Delikte.[11]
[1]
Roxin Täterschaft und Tatherrschaft, S. 25.
[2]
Roxin Täterschaft und Tatherrschaft, S. 26.
[3]
Roxin Täterschaft und Tatherrschaft, S. 26.
[4]
Roxin Täterschaft und Tatherrschaft, S. 25.
[5]
Roxin Strafrecht Allgemeiner Teil, § 25 Rn. 30.
[6]
Roxin Strafrecht Allgemeiner Teil, § 25 Rn. 13.
[7]
Roxin Täterschaft und Tatherrschaft, S. 123 ff.
[8]
Roxin Täterschaft und Tatherrschaft, S. 123, 125.
[9]
Roxin Täterschaft und Tatherrschaft, S. 117.
[10]
Roxin Täterschaft und Tatherrschaft, S. 121.
[11]
Roxin Strafrecht Allgemeiner Teil, § 25 Rn. 14 f.; siehe zur alternativen Täterbestimmung bei diesen Deliktstypen unten Rn. 14.
Teil 2 Grundzüge der Tatherrschaftslehre nach Roxin› A. Methodische Grundlagen› III. Fazit zu den methodischen Grundlagen
III. Fazit zu den methodischen Grundlagen
6
Damit geht Roxin im Rahmen seiner Tatherrschaftslehre von den folgenden methodischen Grundlagen aus: Der Täter wird als Zentralgestalt des handlungsmäßigen Geschehens beschrieben. Zentralgestalt soll dabei in der Regel[1] derjenige sein, der Tatherrschaft hat. Der Täterbegriff ist dabei weder ein unbestimmter noch ein fixierter, sondern vielmehr ein „offener“ Begriff, der es ermöglicht, Tatherrschaft und damit letztlich Täterschaft anhand eines beschreibenden Verfahrens ebenso flexibel wie generalisierend zu bestimmen. Die Offenheit des Täterbegriffes soll dabei dazu dienen, einen Ausgleich zwischen der Erfassung verschiedenster Lebenssachverhalte einer- und dem Bedürfnis nach vorgefassten Kriterien anderseits, zu schaffen.[2]
Читать дальше