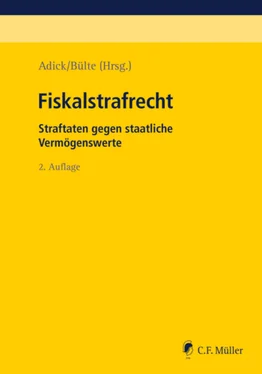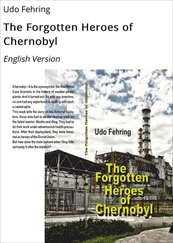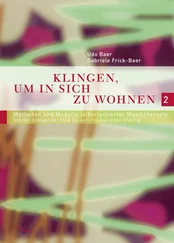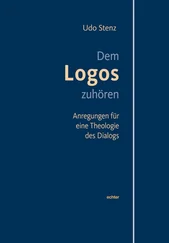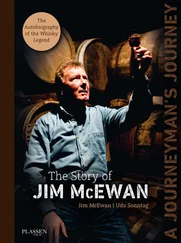26
Auch wenn diese Lösung des BGH im Ergebnis wohl richtig sein dürfte, offenbart sie jedoch durchaus Missverständnisse des europäischen Strafrechts. Der BGH erkennt zwar explizit die richtlinienkonforme Auslegung an und erstreckt sie auch grundsätzlich auf das gesamte nationale Recht, zieht daraus jedoch unzutreffende Schlüsse und missachtet seine Vorlagepflicht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV.[10] Der bedenkliche Ansatz des BGH liegt in der Feststellung, die europäische Richtlinie gegen unlautere Geschäftspraktiken dürfe nicht dazu missbraucht werden, Geschäfte, die allein auf die Täuschung des Verbrauchers angelegt sind, aus dem Betrugstatbestand auszuschließen. Diese Begründung hat Züge der petitio principii, strafbare Handlungen könnten nicht in den Anwendungsbereich der Grundrechte fallen, weil dies einen Grundrechtsmissbrauch bedeute. Der 2. Strafsenat beachtet mit seiner Theorie der Grenzen richtlinienkonforme Auslegung nicht, dass Richtlinien des Unionsrechts, wenn sie ein verbotenes Verhalten umschreiben, im Umkehrschluss auch einen Freiheitsraum schaffen können.[11] Daher muss ein Gericht, das nationales Betrugsstrafrecht anwendet, zunächst den Anwendungsbereich und die Reichweite einer möglicherweise relevanten Unionsrichtlinie klären, um die Frage zu beantworten, ob und wie das Unionsrecht wirkt. Das erfordert jedoch – soweit es sich nicht um einen Acte-Claire handelt – die Anrufung des EuGH. Der BGH hat damit das Recht auf den gesetzlichen Richter verletzt.[12]
[1]
Vgl. hierzu u.a. EuGH NJW 1971, 1006 ff. – Köster; Slg. 1987, 3969, 3986 – Kolpinghuis Nijmegen; ferner Hecker JuS 2014, 385 ff.; Sieber/Satzger/v. Heintschel-Heinegg/ Satzger § 9 Rn. 50 ff.
[2]
EuGH EuZW 1999, 476 – Kortas; vgl. ferner EuGH NJW 1984, 2022 f. – Auer; Wabnitz/Janovsky/ Dannecker / Bülte Kap. 2 Rn. 216.
[3]
Zur Nichtumsetzung von Richtlinien auch EuGH NJW 1992, 165 ff. – Francovic.
[4]
EuGH 5.4.1979 – Rs.148/8, Slg. 1979, 1629.
[5]
EuGH EuZW 2000, 88 – Arblade/Leloup; Wabnitz/Janovsky/ Dannecker / Bülte Kap. 2 Rn. 240.
[6]
EuGH EuZW 2000, 88; vgl. auch Wabnitz/Janovsky/ Dannecker / Bülte Kap. 2 Rn. 216.
[7]
EuGH EuZW 1999, 52; vgl. auch Wabnitz/Janovsky/ Dannecker/Bülte Kap. 2 Rn. 241.
[8]
BGH wistra 2014, 394 ff.; mit Besprechung: Müller NZWiSt 2014, 393 ff.
[9]
Vgl. BGH wistra 2014, 394, 397 unter Hinweis auf Vergho wistra 2010, 86, 90 f.
[10]
So ausdrücklich Hecker / Müller ZWH 2014, 329, 333; zur weiteren Kritik an dieser Entscheidung vgl. nur Cornelius StraFO 2014, 477; Müller NZWiSt 2014, 393 ff.
[11]
Vgl. Hecker / Müller ZWH 2014, 329, 333.
[12]
Vgl. auch Hecker / Müller ZWH 2014, 329, 333; zur weiteren Kritik an dieser Entscheidung vgl. nur Cornelius StraFO 2014, 477; N. Müller NZWiSt 2014, 393 ff.
2. Kapitel Europäisierung des Strafrechts› IV. Unionsrechtskonforme Auslegung› 2. Rahmenbeschlusskonforme Auslegung
2. Rahmenbeschlusskonforme Auslegung
27
In der Entscheidung Pupino [1] hat der EuGH weiterhin ausgeführt, ein europäischer Rahmenbeschlusskönne den einem Richter eingeräumten Entscheidungsspielraum dahingehend beschränken, dass er seine Entscheidung im Interesse der Umsetzung der Ziele des Rahmenbeschlusses und unter Berücksichtigung der Grundsätze des Unionsrechts (hier: Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und Recht auf faires Verfahren) zu treffen hat. In der Entscheidung mahnt der EuGH an:
Die Verpflichtung des nationalen Gerichts, bei der Auslegung der einschlägigen Vorschriften seines nationalen Rechts den Inhalt eines Rahmenbeschlusses heranzuziehen, endet, wenn dieser nicht so angewandt werden kann, dass ein Ergebnis erzielt wird, das mit dem durch den Rahmenbeschluss angestrebten Ergebnis vereinbar ist. Mit anderen Worten darf der Grundsatz gemeinschaftsrechtskonformer Auslegung nicht zu einer Auslegung contra legem des nationalen Rechts führen. Er verlangt jedoch, dass das nationale Gericht gegebenenfalls das gesamte nationale Recht berücksichtigt, um zu beurteilen, inwieweit es so angewendet werden kann, dass kein dem Rahmenbeschluss widersprechendes Ergebnis erzielt wird. [2]
[1]
EuGH EuZw 2005, 433 ff. – Pupino; Wabnitz/Janovsky/ Dannecker / Bülte Kap. 2 Rn. 289.
[2]
EuGH EuZw 2005, 433 ff. – Pupino, Rn. 44.
2. Kapitel Europäisierung des Strafrechts› IV. Unionsrechtskonforme Auslegung› 3. Grenzen der unionsrechtskonformen Auslegung
3. Grenzen der unionsrechtskonformen Auslegung
28
Die unionsrechtskonforme Auslegung im Strafrecht findet ihre Schranken zunächst in den Grenzen der Unionskompetenzen selbst. Daher kommt eine unionsrechtskonforme Auslegung nur soweit in Betracht, wie auch das anzuwendende Strafrecht der Durchführung des Unionsrechts dient. Insofern ist jedoch Folgendes zu beachten: Der EuGH versteht den Begriff der Durchführung von Unionsrechtin der Entscheidung Akerberg Fransson [1] weit, so dass auch der Schutz der Durchführung von Unionspolitiken durch flankierendes Strafrecht (hier: strafrechtlicher Schutz von Mehrwertsteueransprüchen) ausreichend ist, um den notwendigen Konnex zum europäischen Recht herzustellen.
29
Hierzu hat sich das BVerfG allerdings in einem obiter dictum der Entscheidung zur Anti-Terror-Datei kritisch geäußert und sich vorbehalten, eine Anwendung von Unionsrecht, die zu einer Verletzung der Verfassungsidentität[2] der Bundesrepublik Deutschland führen sollte, zu unterbinden.[3]
30
Darüber hinaus findet die unionsrechtskonforme Auslegung im Strafrecht – auch nach der Judikatur des EuGH[4] – ihre Grenzen in dem auch im Unionsrecht anerkannten Grundsatz nullum crimen sine lege.[5] Daher darf ein nationales Gesetz nicht nur aus national-verfassungsrechtlichen Gründen (für Deutschland aus Art. 103 Abs. 2 GG) keinesfalls über seinen Wortlaut hinaus strafbegründend oder strafschärfend ausgelegt werden. Der Wortlaut des Gesetzes wirkt – das hat der EuGH in der Rechtssache Pupino [6] deutlich gemacht – auch in einem europäisierten mitgliedstaatlichen Strafrecht als äußerste Grenze der Strafbarkeit. Ferner steht außer Zweifel, dass eine Auslegung, die zur Verletzung von Menschenrechten oder europäischen Grund- und Freiheitsrechtenführen würde, keine unionsrechtskonforme Auslegung darstellen kann. Der EuGH hat sich in der Entscheidung Steffensen [7] dazu wie folgt geäußert:
Die Grundrechte gehören zu den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, deren Wahrung der EuGH zu sichern hat.“ Ferner heißt es in der Berlusconi-Entscheidung: „Daraus folgt, dass dieser Grundsatz [hier lex mitior] als Bestandteil der allgemeinen Rechtsgrundsätze des Gemeinschaftsrechts anzusehen ist, die der nationale Richter zu beachten hat, wenn er das nationale Recht, das zur Durchführung des Gemeinschaftsrechts erlassen wurde, und im vorliegenden Fall insbesondere die Richtlinien zum Gesellschaftsrecht anwendet.
Auch aus der Entscheidung Jeremy F. [8] wird deutlich, dass die europäischen Grundrechtesowie die Grundsätze des Unionsrechts stets zu berücksichtigensind, wenn harmonisiertes Recht angewendet wird.
a) Grenzen der nationalen Grundrechte im Verfahrensrecht (Taricco)
Читать дальше