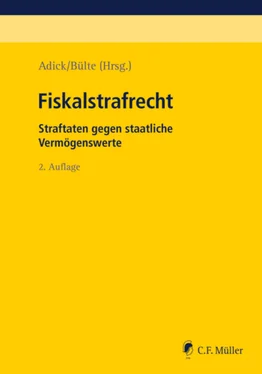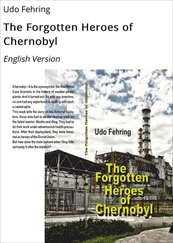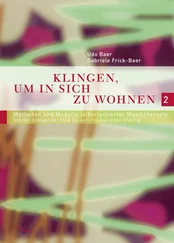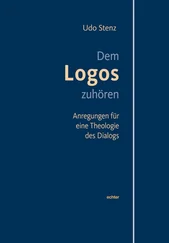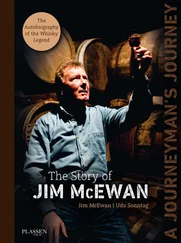44
Unter Berufung auf diese Freiheitsrechte hat der EuGH in der Rechtssache Keck entschieden, dass nicht nur jede mengenmäßige Beschränkung des Handelns innerhalb der Union durch mitgliedstaatliches Recht verboten ist, sondern auch jede Maßnahme, die wie eine mengenmäßige Beschränkung wirkt. Das Verbot gilt damit für alle Maßnahmen, die geeignet sind,
den innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu behindern. Unter diese Definition fallen Hemmnisse für den freien Warenverkehr, die sich in Ermangelung einer Harmonisierung der Rechtsvorschriften daraus ergeben, daß Waren aus anderen Mitgliedstaaten, die dort rechtmäßig hergestellt und in den Verkehr gebracht worden sind, bestimmten Vorschriften entsprechen müssen (…), selbst dann, wenn diese Vorschriften unterschiedslos für alle Erzeugnisse gelten, sofern sich die Anwendung dieser Vorschriften nicht durch einen Zweck rechtfertigen lässt, der im Allgemeininteresse liegt und den Erfordernissen des freien Warenverkehrs vorgeht. [6]
In der Rechtssache Morellato [7] hat der EuGH dementsprechend die Verhängung eines Bußgeldes wegen Inverkehrbringens eines in Frankreich rechtmäßig hergestellten Brotes in Italien für unzulässig erklärt: Eine solche Sanktion stelle sich als grundsätzlich unzulässige, weil einer mengenmäßigen Beschränkung ähnliche Maßnahme dar.
[1]
Vgl. EuGH IStR 2006, 132 ff. – Optigen m. Anm. Dübbers ; DStR 2006, 1274 ff. – Kittel; IStR 2008, 627 ff. – Sosnowska.
[2]
Wabnitz/Janovsky/ Dannecker / Bülte Kap. 2 Rn. 228 ff.
[3]
EuGH GRUR Int. 1974, 467 – Dassonville; NJW 1979, 1766 – Cassis de Dijon.
[4]
EuGH LMRR 1997, 69 f. – Morellato; vgl. auch Rengeling/Middeke/Gellermann /Dannecker/Müller § 39 Rn. 32.
[5]
EuGH Slg. 1981, 2595 ff. – Casati; NJW 1996, 579 ff. – Gebhard; Wabnitz/Janovsky/ Dannecker / Bülte Kap. 2 Rn. 271; Rengeling/Middeke/Gellermann /Dannecker/ Müller § 39 Rn. 35; Sieber/Satzger/v. Heintschel-Heinegg/ Vogel / Brodowski § 5 Rn. 44.
[6]
EuGH 24.11.1993 – Keck, Slg. 1993, 6097 ff.
[7]
EuGH LMRR 1997, 69 f. – Tomasso Morellato .
2. Kapitel Europäisierung des Strafrechts› V. Begrenzung nationalen Strafrechts durch europäische Freiheitsrechte und Grundfreiheiten in der Rechtsprechung des EuGH› 2. Allgemeines Diskriminierungsverbot (Art. 18 ff. AEUV)
2. Allgemeines Diskriminierungsverbot (Art. 18 ff. AEUV)
45
Art. 18 ff. AEUV normieren ein allgemeines Diskriminierungsverbot[1], das die Gleichbehandlung von Angehörigen des eigenen Staates und eines anderen Mitgliedstaates – unter ansonsten gleichen Voraussetzungen – gebietet. Das Diskriminierungsverbot gilt auch für das Strafrecht und Strafverfahrensrecht einschließlich des Rechts der Entschädigung der Opfer von Straftaten.[2] In den Entscheidung Gebhard und Auer (vgl. auch Rn. 47 ff.) wurde deutlich, dass eine Sanktionierung wegen unzulässiger Berufsausübung mit dem Unionsrecht unvereinbar ist, wenn die Berufsausübung unter Verstoß gegen die Freizügigkeit oder das Diskriminierungsverbotverwehrt worden ist.[3]
[1]
Hierzu Wabnitz/Janovsky/ Dannecker / Bülte Kap. 2 Rn. 229.
[2]
EuGH NJW 1989, 2183 – Cowan; Rengeling/Middeke/Gellermann /Dannecker/ Müller § 39 Rn. 38.
[3]
EuGH NJW 1984, 2022 f. – Auer; Rengeling/Middeke/Gellermann /Dannecker/ Müller § 39 Rn. 33.
2. Kapitel Europäisierung des Strafrechts› V. Begrenzung nationalen Strafrechts durch europäische Freiheitsrechte und Grundfreiheiten in der Rechtsprechung des EuGH› 3. Steuerneutralität
46
Den Grundsatz der Steuerneutralität hat der EuGH in einer Vielzahl von Entscheidungen betont: In der Rechtssache Kittel hat der EuGH entschieden, die Steuerneutralitätgebiete, verbotene Umsätze grundsätzlich steuerlich nicht anders zu behandeln als nicht verbotene.[1] In der Rechtssache Sosnowska [2] hat der EuGH den Grundsatz der Steuerneutralität und das Recht auf einen Vorsteuerabzug noch einmal deutlich bestätigt. Ein Wirtschaftsteilnehmer darf nach dieser Rechtsprechung steuerlich keinen Nachteil dadurch erleiden, dass er eine Leistung über die Binnengrenzen der Union und nicht rein national anbietet oder erbringt.[3]
[1]
EuGH DStR 2006, 1274-1278 ( Kittel ); vgl. auch Bülte BB 2010, 1759 ff.; ferner Wabnitz/Janovsky/ Dannecker / Bülte Kap. 2 Rn. 225 ff.
[2]
EuGH DStRE 2009, 438.
[3]
Vgl. auch EuGH DStR 2007, 1811, 1813 – Teleos; vgl. auch Bülte CCZ 2009, 98 ff.
2. Kapitel Europäisierung des Strafrechts› V. Begrenzung nationalen Strafrechts durch europäische Freiheitsrechte und Grundfreiheiten in der Rechtsprechung des EuGH› 4. Niederlassungsfreiheit (Art. 49 ff. AEUV)
4. Niederlassungsfreiheit (Art. 49 ff. AEUV)
47
Besonders deutlich kann die Wirkung der Verkehrsfreiheiten und Freiheitsrechte des Unionsrechts, hier insb. der Niederlassungsfreiheit,[1] auf die straffreie Berufsausübung an der Entscheidung Gebhardt illustriert werden: Gegenstand dieses Urteils des EuGH war der Fall eines deutschen Rechtsanwalts mit Zulassung in Stuttgart, der in Italien tätig war. Er war zunächst als angestellter Anwalt beschäftigt, eröffnete dann aber eine eigene Kanzlei in Mailand. Dort war er als außergerichtlicher Beistand tätig und beriet deutschsprachige Personen in Italien sowie italienischsprachige Deutsche und Österreicher. Einen kleinen Anteil seiner Tätigkeit machte die Beratung italienischer Kollegen im deutschen Recht aus. Aufgrund einer Beschwerde der Sozietät, in der er zunächst angestellt gewesen war, kam es zu einem berufsrechtlichen Disziplinarverfahren. In diesem Verfahren wurde gegen ihn eine Sanktion verhängt, weil Gebhardt ohne italienische Anwaltszulassung praktizierte.[2]
Der EuGH hat diese Sanktion als unzulässige Diskriminierungund als Verstoß gegen Art. 52 Abs. 2 EGV unter Berücksichtigung der Richtlinie zur Anerkennung von Diplomen, die als Ausprägung der Niederlassungsfreiheit anzusehen ist, qualifiziert. Ähnlich hat der EuGH im Fall Auer [3] entschieden, in dem einem Tierarzt in Frankreich die Zulassung verweigert worden war, weil er nicht über ein französisches Diplom verfügte.
48
Der Gerichtshof führte in der Entscheidung zur Rechtssache Gebhardt aus: Das Gericht des Mitgliedstaates hätte überprüfen müssen, ob Gebhardt für die konkrete, von ihm ausgeübte Beratungstätigkeit aufgrund seiner Berufserfahrung und Zulassung in Deutschland fachlich hinreichend qualifiziertwar. Nur wenn ein Dienstleister, der nicht über eine Zulassung verfügt, Beratungsleistungen ohne die Gewähr der notwendigen Fachkenntnisse anbietet, sei eine Sanktion zulässig. Ein hinreichender Grund für eine Andersbehandlung liege aber nicht bereits darin, dass der Betroffene in dem Staat, in dem er tätig ist, über keine Anwaltszulassung verfügt. Strafvorschriften, die eine Ausübung bestimmter Berufe als unerlaubt sanktionieren, seien nur unter engen Voraussetzungen zulässig. Sie dürfen zu keiner Diskriminierungder Angehörigen anderer Mitgliedstaaten führen, müssen durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt werden sowie geeignet und verhältnismäßig sein.[4]
Читать дальше