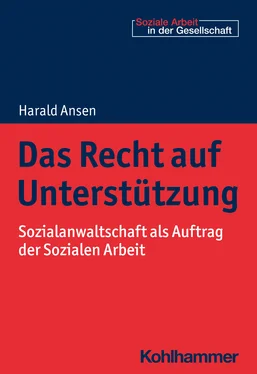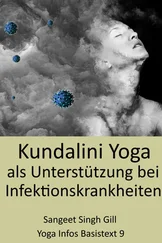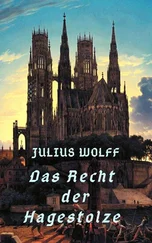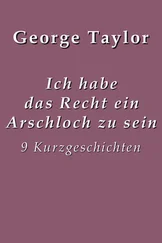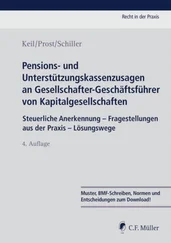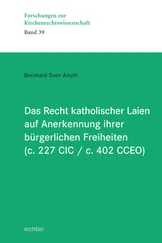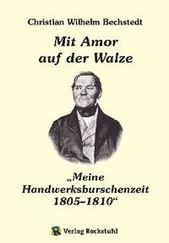1. Rechtliche Interventionsform
Hierbei geht es um Schutzrechte wie beispielsweise den Mieter:innen- oder den Pfändungsschutz sowie um Anspruchsrechte auf unterschiedliche Sozialleistungen. Entscheidend ist, den rechtlichen Status der Bürger:innen zu verbessern, die nicht Bittsteller:innen, sondern Leistungsberechtigte sind. Um Rechte wahrnehmen zu können, ist ein Rechtsbewusstsein ebenso erforderlich wie der Ausgleich von Machtunterschieden in der Durchsetzung rechtlicher Positionen (vgl. Kaufmann 2009, 90f.).
2. Ökonomische Interventionsform
Die Verbesserung der materiellen Lebenslage steht im Mittelpunkt dieser Interventionsform. Erst eine ausreichende Ressourcenausstattung ermöglicht soziale Teilhabe in einer Marktgesellschaft. Zu fragen ist nach der Höhe und Ausgestaltung der Leistungen und ihrer sozialadministrativen Erbringung. Je klarer die Leistungen und je einfacher der Weg zur Realisierung, desto höher ist die Chance, dass diese auch bei den Berechtigten ankommen (vgl. ebd., 92f.).
3. Ökologische Interventionsform
Die Gestaltung des Lebensraums auch durch die Etablierung sozialer Dienste und Einrichtungen zählt zur Daseinsvorsorge. Erst wenn die soziale Infrastruktur auch hinreichend zugänglich ist, erfüllt sie ihre Funktion der Förderung sozialer Teilhabe und der Verbesserung der Lebenslage. Für die Inanspruchnahme bzw. für Barrieren der Inanspruchnahme sind anerkannte Punkte, die einen Zugang garantieren, individuelle Handlungsfähigkeiten, Wissen um Angebote, subjektiver Leidensdruck, die Zugangsbedingungen und die Qualität der Interaktion im Hilfeprozess ausschlaggebend (vgl. ebd., 96f.).
4. Pädagogische Interventionsform
Die Steigerung der Handlungsfähigkeiten und der Handlungsmotivation prägt pädagogische Interventionen, die der Umsetzung eines Selbsthilfeanspruchs dienen. Im weiteren Sinn geht es um die Förderung sozialer Kompetenzen in sozialen Lernprozessen (vgl. ebd., 101f.).
Soweit Probleme standardisiert und mit generalisierten Angeboten gelöst werden können, dominieren einzelfallübergreifende gesetzliche Maßnahmen. Immer dann, wenn stärker auf den Einzelfall einzugehen ist, kommt die Soziale Arbeit als integraler Bestandteil der sozialen Interventionen ins Spiel. Die Durchsetzung von Rechtsansprüchen (rechtliche Interventionsform) erfordert teilweise individuelle Wissensvermittlung und die Förderung der Motivation der Ratsuchenden oder auch sozialarbeiterische Antragsbegründungen und Gutachten, die für Ermessensentscheidungen grundlegend sein können. Hinsichtlich der ökonomischen Interventionsform geht es sozialarbeiterisch im weiteren Sinn um die Erschließung und Organisation alltagsrelevanter Ressourcen. In der ökologischen Interventionsform geht es um Beiträge der Sozialen Arbeit zur Sozialplanung und um unterschiedliche Varianten der Gemeinwesenarbeit. In Bezug auf die pädagogische Interventionsform ist beispielsweise die soziale Beratung geeignet, Wissen und Kompetenzen zu vermitteln und Ratsuchende ganz konkret im Umgang mit rechtlichen, ökonomischen und ökologischen Aspekten ihrer Lebenslage zu unterstützen (vgl. Kaufmann 2012, 1298f.).
Das im Sozialrecht zum Ausdruck kommende Sozialstaatsverständnis, unter dessen Dach das Recht auf Unterstützung auch durch die Soziale Arbeit verwirklicht wird, ist recht elastisch, auch wenn dies in der Realität nicht immer zum Ausdruck kommt. Zu fragen ist, ob Verbesserungen der sozialstaatlichen Praxis jenseits grundlegend neuer Strukturen möglich sind, die gegenwärtig nicht auf der Tagesordnung stehen. Der Bedarf, die Praxis des Sozialstaats zu verbessern, ist sowohl empirisch als auch sozialethisch begründet.
Zunächst zur empirischen Lage: Die Zufriedenheit mit der öffentlichen Verwaltung bzw. der Bürokratie ist nach aktuellen Daten einer repräsentativen Zufallsstichprobe unterschiedlich verteilt. In der Gesamttendenz besteht große Zufriedenheit mit der Interaktion zwischen Bürger:innen und den Behörden. Die Zufriedenheitswerte von Menschen in benachteiligten Lebenslagen, geprägt von Erwerbslosigkeit, Altersarmut und finanziellen Problemen, sind allerdings deutlich geringer. Auf einer Skala von -2 bis +2 rangieren sie zwischen 0,7 und 0,8 (vgl. Datenreport 2021, 395). Die im Vergleich nach unten abweichenden Werte bei diesen Bevölkerungsgruppen hängen eng mit der Verständlichkeit von Formularen und Anträgen, zu langen Warte- und Bearbeitungszeiten, unzureichenden Informationen, nicht verständlichen Ablehnungsbescheiden und einem als unfreundlich und wenig kompetent erlebten Personal zusammen (vgl. ebd., 396f.). Die für die tendenziell negative Bewertung ausschlaggebenden Faktoren können ohne einen Systemumbau durch eine Überprüfung der gesetzlichen Regelungen hinsichtlich ihrer Unübersichtlichkeit und Komplexität sowie durch eine Reorganisation der Verwaltungsabläufe, die vor Willkür schützen sollen und die sich gegenüber den auf Unterstützung angewiesenen Menschen zu legitimieren haben und nicht umgekehrt, überwunden werden.
Wenn Menschen sich im Umgang mit der Bürokratie schlecht behandelt, zuweilen herabgesetzt fühlen, verweist dies auf Entwicklungen, die auch sozialethisch anstößig sind. Eine Demütigung hängt mit Verhaltensweisen und/oder Verhältnissen zusammen, die Menschen einen rationalen Grund geben, sich in ihrer Selbstachtung verletzt zu sehen (vgl. Margalit 1999, 23). Übertragen auf den Sozialstaat und seine Bürokratie stehen potenziell demütigende Elemente bei einer nicht ausreichenden Würdigung des Einzelfalls, einer Behandlung der Leistungsberechtigen als Nummer und nicht als Subjekt, der Unterstellung, dass sie Leistungen zu Unrecht beantragen und nur zu faul sind, für sich selbst zu sorgen, oder auch einer paternalistischen Bevormundung in der Sachbearbeitung im Raum. Überdies kann auch dann von einer Demütigung gesprochen werden, wenn erniedrigende Lebensverhältnisse nicht mit den Mitteln des Sozialstaats überwunden werden oder wenn Rechtsansprüche auf Leistungen immer weiter reduziert werden (vgl. ebd., 256f.). Liest man diese Kriterien unter der Vorgabe, wie sich Demütigungen im Sozialstaat vermeiden lassen, folgen daraus Anforderungen, wonach
• der Einzelfall in der Leistungsbearbeitung explizit zu würdigen ist,
• der unbegründete Verdacht auf Leistungsmissbrauch zu unterlassen ist,
• Menschen an Entscheidungen über ihre Anträge zu beteiligen sind,
• der Wille erkennbar wird, die benachteiligenden Lebensumstände zu überwinden, und
• ausreichende Rechtsgrundlagen zu schaffen sind, die dazu beitragen, das Risiko willkürlicher Entscheidungen zu vermeiden.
Darüberhinausgehend sind aus ethischer Sicht für die Erbringung von Sozialleistungen auch Anregungen von Immanuel Kant aktuell bedeutsam. Kants Überlegungen zur Würde des Menschen, ausgeführt in »Die Metaphysik der Sitten« (1797) im Kapitel über die Tugendpflichten gegen andere, werden noch heute für die Interpretation von Artikel 1 des Grundgesetzes herangezogen. Danach ist die Würde eines Menschen über jeden Preis erhaben, sie hat keine materielle oder finanzielle Entsprechung. Die Würde eines Menschen impliziert die Aufforderung, ihn zu keiner Zeit als Mittel zum Zweck zu gebrauchen, der Mensch ist immer Zweck seiner selbst, völlig unabhängig davon, was er (nicht) geleistet hat (vgl. Kant 2001, 354f.). Vor diesem Hintergrund heißt es bei Kant über den Umgang mit von Armut belasteten Menschen:
»So werden wir gegen einen Armen wohltätig zu sein, uns für verpflichtet erkennen; aber weil diese Gunst doch auch Abhängigkeit seines Wohls von meiner Großmut enthält, die doch den anderen erniedrigt, so ist es Pflicht, dem Empfänger durch ein Betragen, welches diese Wohltätigkeit entweder als bloße Schuldigkeit oder geringen Liebesdienst vorstellt, die Demütigung zu ersparen und ihm seine Achtung für sich selber zu erhalten« (ebd., 336f.).
Читать дальше