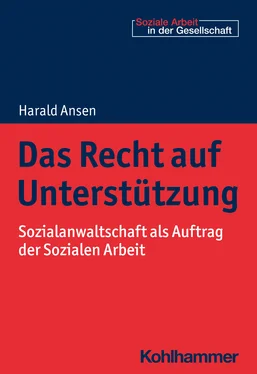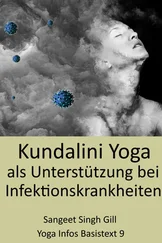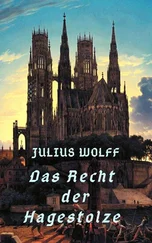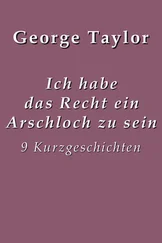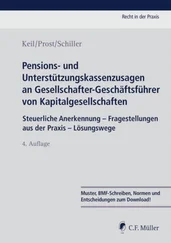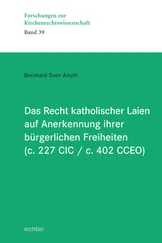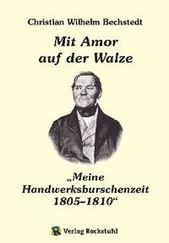Von Überschuldung wird in Abgrenzung zur Verschuldung gesprochen, wenn das Einkommen und Vermögen aller Haushaltsmitglieder trotz einer Reduzierung des Lebensstandards längerfristig nicht mehr ausreichen, um den Lebensunterhalt zu bestreiten und fällige Forderungen zu bedienen.
Unter den gegenwärtig rund sieben Millionen Überschuldeten in Deutschland sind Menschen in armutsgeprägten Lebenslagen überproportional vertreten. Eine Überschuldung gefährdet nicht nur die materiellen Lebensgrundlagen, etwa bei Miet- oder Energieschulden; belastende Auswirkungen auf die Familie und das persönliche Umfeld sind ebenso nachgewiesen wie die Konfrontation mit anhaltendem Stress und weitergehenden Verlusten sowie gesundheitlichen Einschränkungen (vgl. Ansen 2018a, 20).
In Verbindung mit Einkommensarmut ist die Wohnungsfrage eine zentrale Komponente der sozialen Sicherung. Ein geringes Einkommen führt vielfach zu Problemen in der Wohnsituation. Für die Soziale Arbeit, die sich für ein Recht auf Unterstützung auch in diesem Bereich des Alltags einzusetzen hat, ist es weiterführend, die Bedeutung des Wohnens für das Leben in der Gesellschaft zu würdigen. Eine ausreichende und menschenwürdige Wohnung ermöglicht eine Privatsphäre, ein Leben in Partnerschaft und Familie, Schutz und Regenerationsmöglichkeiten, die Wahrnehmung einer Erwerbstätigkeit, kurz eine bürgerliche Existenz (vgl. Ansen 2018c, 176). Das heute unstrittige Ziel der Teilhabe an der Gesellschaft ist ohne adäquate Wohnungsversorgung nicht zu realisieren. Menschen in Armut erleben in diesem Zusammenhang vielfältige Benachteiligungen. Diese beginnen bereits bei der Wohnkostenbelastung. Während in der Bevölkerung durchschnittlich 27 Prozent des verfügbaren Einkommens für Wohnkosten ausgegeben werden, wenden Menschen in Armutshaushalten etwa 51 Prozent für das Wohnen auf (vgl. Spellenberg & Giehl 2019, 272). Diese hohe Wohnkostenbelastung ist äußerst riskant. Kommt es zu Einkommenseinbußen, können diese kaum noch kompensiert werden, sodass Schulden einschließlich Mietschulden auftreten, die zu fristloser Kündigung und im Extremfall zur Zwangsräumung führen. Die hohe Mietbelastung ist wie ein Damoklesschwert für die betroffenen Haushalte. Die Schwelle zum Wohnungsnotfall, wie ihn die BAG-Wohnungsloshilfe versteht (s. Kasten) ist in diesen Konstellationen deutlich herabgesetzt.
Wohnungsnotfälle liegen vor,
• wenn Menschen ohne eigene Wohnung auf der Straße oder in Notquartieren bzw. in unsicheren privaten Arrangements leben,
• wenn Menschen ohne mietvertragliche Absicherung wohnen,
• wenn sie in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe versorgt werden,
• wenn Menschen von einer Räumungsklage akut bedroht sind,
• wenn sie in völlig unzureichenden Wohnungen leben, insbesondere bei Überbelegung oder in gesundheitsschädigenden Verhältnissen,
• wenn sie nur wegen einer fehlenden Wohnung in Einrichtungen bleiben, etwa der Jugendhilfe oder in Frauenhäusern,
• oder wenn sie nach der Überwindung von Wohnungslosigkeit auf nachgehende stabilisierende Hilfen angewiesen sind.
Ein Wohnungsnotfall strahlt auf sämtliche Lebensbereiche aus, die Betroffenen sind massiven existenziellen Belastungen und Gefährdungen ausgesetzt, die ihre Lebenschancen deutlich verringern. Nach jüngsten Daten der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe sind aktuell 678.240 Menschen in Deutschland wohnungslos. Die Soziale Arbeit steht hier vor großen armutsbedingten Herausforderungen, die nicht den Betroffenen persönlich angelastet werden dürfen, wie es teilweise zu beobachten ist.
Wie wichtig es ist, Armut mit ihren kumulativ auftretenden Belastungen zu erfassen, wird deutlich, wenn beispielsweise der Zusammenhang zwischen sozialer und gesundheitlicher Ungleichheit einbezogen wird. Soziale Ungleichheit, für die u. a. Armut ein zentraler Faktor ist, wird in der Sozialforschung am verfügbaren Einkommen, dem Erwerbsstatus und dem Bildungsniveau gemessen. Benachteiligungen in diesen Bereichen erhöhen die Risiken für chronische Erkrankungen im Vergleich mit höheren Statusgruppen um das Zwei- bis Dreifache. Vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Stoffwechselstörungen, Krankheiten des Bewegungs- und Stützapparates, Tumore und psychische Störungen werden registriert. Auch die durchschnittliche Lebenserwartung unterscheidet sich signifikant. Sie liegt bei sozial und wirtschaftlich benachteiligten Bevölkerungsgruppen um fünf bis zehn Jahre unter der Lebenserwartung bessergestellter Gruppen. Gründe für die erhöhten Krankheitsbelastungen und die geringere Lebenserwartung korrelieren nach sozialepidemiologischen Befunden mit den materiellen Einschränkungen, den psychosozialen Belastungen und dem Gesundheitsverhalten der betroffenen Menschen (vgl. Lampert 2018, 12f.).
Während die soziale Sicherung in Bezug auf die individuelle Ausstattung der Menschen behandelt wird, werden in der Analyse der sozialen Unterstützung die Umweltbedingungen in Gestalt persönlicher sozialer Netze, formeller Dienste und Einrichtungen und sozialräumlicher Lebensbedingungen einbezogen. In Bezug auf soziale Netzwerke fällt auf, dass in Armut lebende Menschen häufiger in sozial und milieubezogen homogenen Beziehungen leben und eher auf Familienangehörige und Nachbar:innen zurückgreifen, während in sozialökonomisch besser ausgestatteten Kreisen der Bevölkerung eher heterogene Netzwerkstrukturen mit deutlich mehr Ressourcen anzutreffen sind. Menschen in sozial benachteiligten Lebenslagen bleiben nach diesen Befunden weitgehend unter sich, verbunden mit einer geringeren Partizipation an der Gesellschaft, durch die soziale Ausgrenzungsverfahren verfestigt werden (vgl. Böhnke & Link 2019, 247f.). Neben dem Erleben sozialer Ausgrenzung in den persönlichen Netzwerken ist zu berücksichtigen, dass soziale Unterstützung durch emotionale, materielle und instrumentelle, informatorische und interpretative Formen des Beistandes (vgl. Kupfer 2015, 136f.) in einem sozial homogenen Umfeld, in dem Menschen in prekären Verhältnissen leben, seltener in der erforderlichen Breite erfolgen kann. Gerade dann, wenn eine facettenreiche Hilfe gebraucht wird, findet sie im Alltag zu wenig statt. Armut und soziale Ausgrenzung werden dadurch weiter verfestigt. Für die Auseinandersetzung mit dem Recht auf Unterstützung ist es deshalb erforderlich, die Dimension der Netzwerkbeziehungen einzubeziehen. Das gilt auch für den Zugang zu formellen Diensten und Einrichtungen des Sozial-, Bildungs- und Gesundheitswesens, die Menschen in Armut aufgrund unterschiedlicher Barrieren nicht immer sachangemessen erreichen. Das Recht auf Unterstützung bleibt gewissermaßen blutleer, wenn vorhandene Angebote aufgrund ihrer Organisationsstrukturen gerade von denjenigen, die darauf besonders dringend angewiesen sind, nicht genutzt werden können.
Barrieren im Sozial-, Bildungs- und Gesundheitswesen
Zu den Barrieren zählen institutionelle und bürokratische Anforderungen, die teilweise überfordernd sind, fehlende Informationen über infrage kommende Varianten der Unterstützung, die Angst vor Stigmatisierung bei der Inanspruchnahme sozialstaatlicher Leistungen, kulturelle Blockaden, vor allem bei denjenigen, die mit der Behördenkultur in Deutschland nicht vertraut sind, und subjektive Faktoren persönlicher Verunsicherung sowie Resignation im Umgang mit den eigenen Problemen (vgl. Papenheim et al. 2018, 217).
Wer in seinem persönlichen sozialen Netzwerk keine Unterstützung für den Rückgriff auf Angebote des Sozialstaats erhält, ist vermehrt auf eine zugängliche und leicht erreichbare Organisation der sozialen Infrastruktur angewiesen und nicht auf einen defensiven Sozialstaat, der ausgeprägte Konfliktfähigkeit in der Beantragung von Sozialleistungen voraussetzt. Das Recht auf Unterstützung überschreitet an dieser Stelle die direkte Fallarbeit, es geht darum, Einfluss auf die Gestaltung der sozialen Infrastruktur zu nehmen. Dies beinhaltet die Gestaltung des Sozialraums und die Vermeidung sozialräumlicher Ausgrenzungen im Sinne einer »residenziellen Segregation« (Keller 2019, 261). Es ist nicht immer ein ganzer Stadtteil, der Ausgrenzungen verkörpert, vielfach sind es Straßen, Straßenzüge oder auch Wohnblocks, in denen vermehrt Armutshaushalte angesiedelt sind (vgl. ebd., 261f.). Für den Umgang mit sozialräumlichen Segregationsprozessen reicht es nicht aus, nur auf bauliche Maßnahmen zu setzen, schließlich geht es darum, das soziale Miteinander im Sinne der gesellschaftlichen Kohärenz zu fördern. Ein sozialräumlicher Ansatz, der hier gefordert ist, impliziert, dass der Raum durch soziales Handeln angeeignet wird. Erst wenn das subjektive Raumerleben einbezogen wird, wenn Menschen Möglichkeiten der Beteiligung vorfinden, denen sie gewachsen sind, wenn ihre Alltagsorganisation, ihre Bedürfnisse und ihre sozialen Bezüge mit sozialpolitischen Maßnahmen in eine Balance gebracht werden, ist es möglich, die negativen Wirkungen sozialräumlicher Ausgrenzungen zu stoppen und eine soziale Infrastruktur aufzubauen, die Lernchancen, Verständnis füreinander und ein unterstützendes Zusammenleben voranbringen (vgl. Alisch 2018, 513f.).
Читать дальше