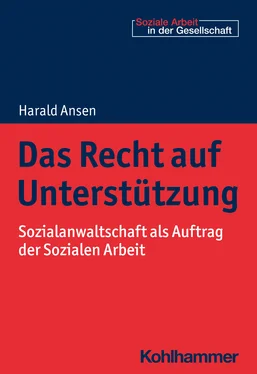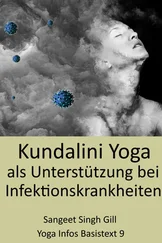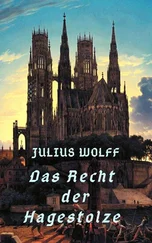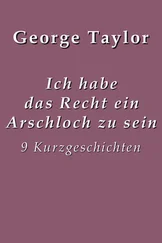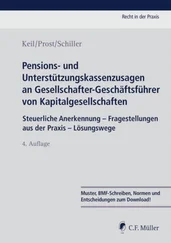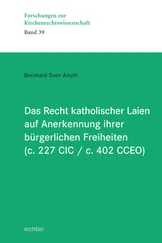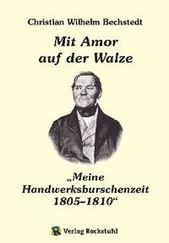Von absoluter Armut ist die Rede, wenn elementare Mittel für die Existenzsicherung nicht verfügbar oder zugänglich sind. Hierzu zählen Obdach, Heizung, Nahrung, Kleidung und elementare medizinische Versorgung (vgl. Hauser 2018, 152).
Diese extreme Form der Armut existiert auch in Deutschland. Wohnungslose Menschen, die auf der Straße oder in menschenunwürdigen Behelfs- und Notunterkünften leben, zählen ebenso zu den Betroffenen wie Menschen ohne gültige Aufenthaltsdokumente, die von Regelleistungen des Sozialstaats ausgeschlossen sind, oder Menschen mit schweren Erkrankungen und Beeinträchtigungen, die es nicht mehr schaffen, Hilfestellen aufzusuchen und/oder sich auf anspruchsvolle Unterstützungsprozesse einzulassen. Mit Menschen, die diesen Gruppen angehören, ist die Soziale Arbeit befasst. Sie stellen die Fachkräfte vor ganz besondere Herausforderungen, geht es doch vielfach zunächst um Überlebenshilfen und die elementare Sicherung der Existenzgrundlagen. Formale Rechte auf Unterstützung wie eine Notübernachtung, Rückkehrhilfe in das Herkunftsland oder eine Drogenbehandlung mögen bestehen, ob sie für die Betroffenen eine tatsächliche Unterstützung darstellen, muss im Einzelfall geklärt werden.
Die relative Armut wird am Lebensstandard der jeweiligen Bezugsgesellschaft gemessen. In diesem Fall reicht die vorhandene Ausstattung nicht mehr aus, eine als gerade noch ausreichend angesehene soziokulturelle Teilhabe zu realisieren (vgl. ebd., 152). An diese Sichtweise schließt die europäische Sozialberichterstattung an. Dort geht man von einer relativen Armut aus, wenn Menschen über so geringe soziale, materielle und kulturelle Mittel verfügen, dass sie von einer gerade noch akzeptablen Lebensweise ihrer Bezugsgesellschaft ausgeschlossen sind (vgl. Datenreport 2021, 224). Relative Armut wird in der Marktgesellschaft am verfügbaren Haushaltsnettoeinkommen gemessen. Liegt ein Haushalt unter 60 Prozent des nach Haushaltsgrößen gewichteten Medianeinkommens, gilt er als relativ arm. Von strenger Armut ist die Rede, wenn das Einkommen unter 50 Prozent des Medianeinkommens liegt.
Bezogen auf die jüngsten vorliegenden Daten lag das Medianeinkommen pro Kopf im Jahr 2018 monatlich bei rund 1.892 EUR (vgl. ebd., 223). Die 60-Prozent-Armutsgrenze liegt demnach bei 1.135 EUR, die 50-Prozent-Armutsgrenze bei 946 EUR. Die in der Armutsforschung breit rezipierte relative Armutsgrenze ist allerdings problematisch. Es wird beispielsweise nicht berücksichtigt, dass Menschen lebenslagebedingt und in Bezug auf gesundheitliche Beeinträchtigungen unterschiedliche Bedürfnisse haben (vgl. Hauser 2018, 156). Hinzu kommt, dass Schuldentilgungen, die in armutsgeprägten Lebenslagen häufiger vorkommen, in der Berechnung der Armutsgrenze nicht berücksichtigt werden. Auch wer wenige Prozentpunkte über der Armutsgrenze liegt, lebt nicht im Wohlstand, sondern allenfalls in prekären Verhältnissen. Unterstellt wird schließlich, dass das Haushaltseinkommen proportional verteilt wird, was keineswegs sichergestellt ist.
Auch wenn absolute Armut in Deutschland quantitativ eine periphere Rolle spielt und relative Armut dominiert, muss die Soziale Arbeit mit beiden Formen in ihrem Arbeitsalltag umgehen, zumal teilweise fließende Übergänge bestehen. Neben der Sicherung der Existenzgrundlagen geht es in der Unterstützung für Menschen in armutsgeprägten Lebensumständen insbesondere um die Förderung ihrer Teilhabe an den Errungenschaften der Gesellschaft. Für die Soziale Arbeit im Umgang mit Armut, die in vielen Bereichen wie der Suchtkrankenhilfe, der Sozialpsychiatrie, dem Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) oder der Migrationssozialarbeit anzutreffen ist, sind Kenntnisse über Grundsicherungs- und Sozialhilfeleistungen unabdingbar, die im SGB II und SGB XII sowie in angrenzenden Sozialleistungsgesetzen geregelt sind. Im System der sozialen Sicherung repräsentieren diese Leistungen ein soziokulturelles Minimum, das gewissermaßen die absolute und die relative Armut vereint. Wer nicht über eigene Mittel, ausreichende Eigenkräfte und/oder einen anderweitigen Anspruch auf Unterstützung, sei es durch Unterhaltsansprüche oder vorrangige Sozialleistungen, verfügt, hat nach dem gegenwärtigen Stand einen Rechtsanspruch auf subsidiär angelegte bedürftigkeitsgeprüfte Grundsicherungs- und Sozialhilfeleistungen. Diese dienen dazu, allen Betroffenen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, das über die reine Existenzerhaltung hinausgeht und in dem mit den Leistungen ein Mindestmaß an gesellschaftlicher, kultureller und politischer Teilhabe sichergestellt werden soll (vgl. Bieritz-Harder 2019, 104).
Der Grundsicherungsanspruch
Während die absolute Armutsgrenze der physischen Lebenserhaltung dient und die relative Armutsgrenze die soziokulturelle Armutsgrenze abbildet, die an einem statistisch festgelegten Normwert gemessen wird, handelt es sich beim Grundsicherungsanspruch um eine politische Armutsgrenze, die in Bezug auf das Recht auf Unterstützung ganz besonders zu beachten ist. Regelbedarfe werden nach dem »Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfe nach § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz)« auf der Grundlage der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe sogenannter einkommensschwacher Haushalte ermittelt. Für Einpersonenhaushalte werden die unteren 15 Prozent, für Familienhaushalte die unteren 20 Prozent der Haushalte ohne die Bezieher:innen von Sozialhilfe- und Grundsicherungsleistungen herangezogen. Eine Begründung für die unterschiedliche Größe der Referenzhaushalte ist dem Gesetz nicht zu entnehmen, sie verzerrt die Ergebnisse der Regelbedarfsberechnung für Einpersonenhaushalte zu deren Lasten.
Von den ermittelten Ausgaben der Referenzhaushalte werden je nach politischer Auffassung noch Posten abgezogen, die für verzichtbar gehalten werden. Auch an dieser Stelle kommt der normative Charakter der Armut zum Ausdruck. Kategorial betrachtet umfasst das soziokulturelle Existenzminimum die Mittel für die physische Lebenssicherung, für die Befriedigung der Bedürfnisse des täglichen Lebens einschließlich Kosten der Unterkunft und Heizung, für Mobilitäts-, Bildungs-, Informations- und Kommunikationsbedarfe, für die Unterhaltung zwischenmenschlicher Beziehungen und für die Nutzung von kulturellen und Freizeitangeboten (vgl. Becker 2017, 273). Betrachtet man die aktuell regelbedarfsrelevanten Verbrauchsausgaben beispielsweise für einen Einpersonenhaushalt, so stehen für Bekleidung und Schuhe monatlich 34,60 EUR oder für Bildung 1,01 EUR zur Verfügung. Für Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres liegt der Anteil für Bekleidung und Schuhe bei 36,25 EUR und für Bildung bei 0,68 EUR, vom siebten bis zum vollendeten 14. Lebensjahr liegt der Anteil für Bekleidung und Schuhe bei 41,83 EUR und für Bildung bei 0,50 EUR. Diese Einblicke unterstreichen einmal mehr, dass lebensweltnahe empirische Studien fehlen, die unter Berücksichtigung besonderer Bedarfe in den jeweiligen Fallkonstellationen Auskunft über eine ausreichende Grundsicherung geben. In Bezug auf das Recht auf Unterstützung ist an dieser Stelle auf den politischen Auftrag der Sozialen Arbeit in der Auseinandersetzung, um eine angemessene Grundsicherung aufmerksam zu machen.
Zieht man die Zahl der Bezieher:innen von Grundsicherungs- und Sozialhilfeleistungen heran, um das Ausmaß von Armut darzustellen, sind etwa acht Millionen Menschen betroffen (vgl. Aust 2019, 101). Gemessen an der 60-Prozent-Armutsgrenze leben derzeit 15,8 Prozent der Bevölkerung an der Armutsgrenze (vgl. Datenreport 2021, 233). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Armutsquote vor dem Bezug von Sozialleistungen bei über 23 Prozent liegt; die Einkommensarmut in Deutschland wird durch Leistungen des Sozialstaats also verringert, aber nicht überwunden (vgl. Bäcker 2019, 302f.). Für die Soziale Arbeit interessant ist die Frage, welche Bevölkerungsgruppen vor allem von Armut betroffen sind, denn diese Daten geben Aufschluss über strukturelle Benachteiligungen. Auf der Grundlage der 60-Prozent-Armutsgrenze sind nach den jüngsten Erhebungen für das Jahr 2018 u. a. junge Menschen mit 20,6 Prozent, Alleinerziehende mit 33,8 Prozent, Menschen mit niedrigem Bildungsabschluss mit 30,5 Prozent und Erwerbslose mit 69,4 Prozent überdurchschnittlich von Armut betroffen (vgl. Datenreport 2021, 225).
Читать дальше