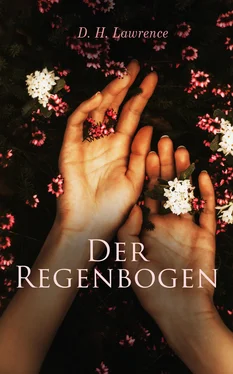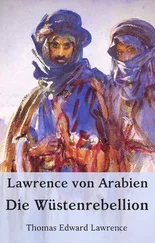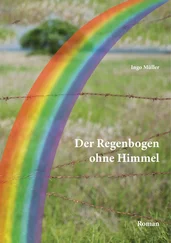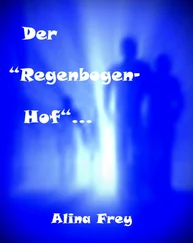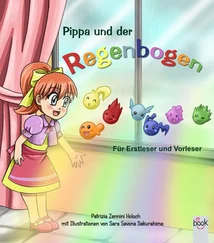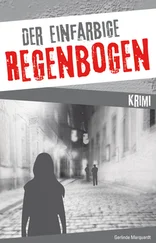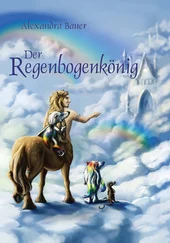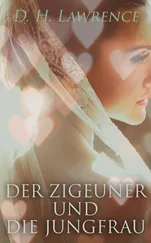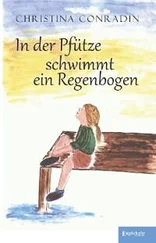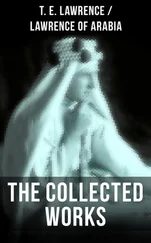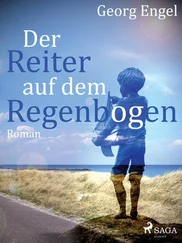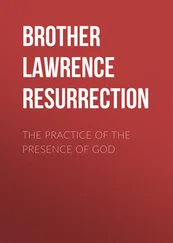Sobald er auf die Schule kam, begann er heftig gegen seine körperliche Unfähigkeit zum Lernen anzukämpfen. Verkniffen saß er da und machte sich ganz blaß und unansehnlich durch seine Anstrengungen, sich über einem Buche zu sammeln, das aufzufassen, was er grade zu lernen hatte. Aber es war umsonst. Wenn er auch den ersten Widerwillen niederkämpfte und wie ein Selbstmörder vor dem Zeugs dastand, er kam nur sehr wenig vorwärts. Es nutzte nichts, daß er sich fest vornahm, zu lernen. Sein Geist arbeitete einfach nicht.
Sein Gemüt dagegen entwickelte sich und wurde sehr empfindlich gegen den ihn umgebenden Dunstkreis; vielleicht war er roh, aber doch zugleich auch empfindsam, sehr empfindsam. Daher rührte die geringe Meinung seiner selbst. Er kannte seine Grenzen. Er wußte, sein Schädel sei ein schwerfälliger, hoffnungsloser Nichtsnutz. So wurde er bescheiden.
Zu gleicher Zeit aber machte er in seinem Gemütsleben doch viel mehr Unterschiede als die meisten anderen Jungens, und das verwirrte ihn. Er war sinnlicher veranlagt und besaß feinere Gefühle als sie. Er haßte sie wegen ihres triebmäßigen Stumpfsinns, litt wieder unter der Verachtung, die er für sie fühlen mußte. Handelte es sich aber um Verstandesangelegenheiten, dann war er im Hintertreffen. Da war er ganz in ihrer Hand. Er war ein Dummkopf. Er besaß nicht Verstand genug, um die dümmste Behauptung zu widerlegen, so daß er gezwungen mancherlei zugab, an das er ganz und gar nicht glaubte. Und hatte er es einmal zugegeben, so wußte er nicht, glaubte er dran oder nicht; gewöhnlich, gestand er sich, glaubte er daran.
Aber jeden, der ihm auf dem Wege über das Gemüt Erleuchtung verschaffen konnte, den liebte er. Er konnte seine Rührung nicht verbergen, als er dasaß und der Lehrer packend Tennysons »Ulysses« oder Shelleys »Ode an den Westwind« vorlas. Seine Lippen öffneten sich, seine Augen füllten sich mit einem sehnenden, beinahe leidenden Licht. Und der Lehrer las weiter, angefeuert durch seine Macht über den Jungen. Durch diese Erfahrung fühlte Tom Brangwen sich über alle Maßen bewegt, er bekam fast Angst vor ihr, so tief ging sie ihm. Als er aber beinahe heimlich und voller Scham versuchte, das Buch selbst vorzunehmen und die ersten Worte begann »O wilder Westwind, Atem du des Herbst«, da verursachte allein schon der Druck ihm ein kitzliges, widerwilliges Gefühl auf der Haut, das Blut trat ihm ins Gesicht und sein Herz füllte sich mit leidenschaftlicher, brennender Wut über seine Unfähigkeit. Er warf das Buch zu Boden, trampelte darauf herum und lief auf das Kricketfeld hinaus. Er haßte Bücher, als wären sie seine Feinde. Er haßte sie schlimmer, als er je einen Menschen gehaßt hatte.
Sein Wille besaß keine Gewalt über seine Aufmerksamkeit. Sein Geist kannte keine festen Gewohnheiten, an die er sich hätte halten können, er fand nichts, um sich daran zu halten, nichts, wovon er hätte ausgehen können. Nichts war ihm greifbar, in sich selbst wußte er nichts, das er fürs Lernen hätte verwenden können. Er wußte nicht, wie er anfangen sollte. Daher war er auch so hilflos, sowie es auf verstandesmäßige Überlegung oder Lernen durch Nachdenken ankam.
Für Mathematik besaß er ein gewisses gefühlsmäßiges Verständnis, ließ ihn dies aber im Stich, so war er hilflos wie ein Schwachsinniger. So merkte er, er werde nie festen Boden unter den Füßen fühlen, er schwamm im Nichts. Der endgültige Niederbruch erfolgte durch seine vollkommene Unfähigkeit, auf eine Frage einzugehen, ohne daß man ihm die Antwort in den Mund legte. Hatte er einen Aufsatz über das Heerwesen zu schreiben, so lernte er endlich die paar ihm bekannten Tatsachen auswendig niederschreiben: »Man kann ins Heer eintreten, sobald man achtzehn Jahre alt ist. Man muß über fünf Fuß acht Zoll groß sein.« Aber die ganze Zeit über fühlte er sich lebendig überzeugt, dies sei nur eine Ausflucht und all diese Binsenwahrheiten seien über alle Begriffe dumm. Dann wurde er rot vor Wut, fühlte wie ihm das Herz in die Hosen sank, strich alles durch, was er geschrieben hatte, machte einen todeskampfähnlichen Versuch, etwas im richtigen Aufsatzstil auszudenken, scheiterte auch daran, wurde vor Wut und Scham gänzlich stumpfsinnig, legte die Feder hin und hätte sich lieber in Stücke reißen lassen, als daß er nun noch ein einziges Wort zu schreiben versucht hätte.
Trotzdem gewöhnte er sich bald an die Lateinschule, und die Schule gewöhnte sich an ihn, indem sie ihn als hoffnungslosen Dämel beim Lernen einschätzte, aber in ihm andrerseits auch den anständigen, ehrlichen Burschen achtete. Nur ein engherziger, herrschsüchtiger Kerl, der Lateinlehrer, quälte ihn und füllte seine blauen Augen mit wahnsinniger Wut und Scham. Es kam zu einem scheußlichen Auftritt, wobei der Junge dem Lehrer mit einer Schiefertafel ein Loch in den Kopf schlug, und dann verlief alles wie vorher. Der Lehrer fand wenig Mitgefühl. Aber Brangwen krümmte sich innerlich und litt unter dem Gedanken an seine Tat, selbst lange nachher noch, als er schon ein Mann war.
Er war froh als er die Schule verlassen konnte. Es war ja zwar nicht ganz ohne Vergnügen gewesen, er hatte sich sehr an dem Zusammensein mit den anderen Jungens gefreut, oder hatte doch geglaubt, er fände Freude daran; die Zeit war rasch in endloser Geschäftigkeit vorübergegangen. Aber die ganze Zeit über hatte er das Gefühl gehabt, sich an diesem Orte der Gelehrsamkeit in unwürdiger Stellung zu befinden. Die ganze Zeit über war er sich seines Mißerfolges, seiner Unfähigkeit bewußt. Aber er war zu gesund, zu vollblütig, um darüber elend zu werden; er war viel zu lebendig. Und doch fühlte sich seine Seele jämmerlich bis zur Hoffnungslosigkeit.
Einen warmherzigen, klugen Jungen von etwas schwächlichem Körperbau, eine Art Schwindsüchtigen, hatte er sehr lieb gehabt. Die beiden verband eine gradezu vorbildliche Freundschaft, wie David und Jonathan, wobei Brangwen Jonathan, der Dienende, war. Aber er hatte sich seinem Freunde nie ebenbürtig gefühlt, weil des anderen Geist den seinigen rasch überflügelte und ihn beschämt weit hinter sich ließ. So kamen die beiden Jungens gleich nach Verlassen der Schule auseinander. Aber Brangwen erinnerte sich noch lange seines ehemaligen Freundes und bewahrte ihm ein Andenken als einer Art Lichterscheinung, einer schönen Lebenserfahrung.
Tom Brangwen war froh, als er wieder auf dem Hofe ankam, wo er sich ganz in seinem Fahrwasser fühlte. »Hab' ja doch nur 'nen Kohlkopf auf den Schultern, laßt mich man auf dem Felde bleiben«, sagte er zu seiner verzweifelten Mutter. Er hatte eine zu schlechte Meinung von sich selbst. Aber an seine Arbeit auf dem Hofe ging er voller Freude, vergnügt über das Herumwirtschaften und den Erdgeruch, voller Jugend und Kraft und guter Laune und mit gutem Mutterwitz, dabei auch willens und imstande, die eigenen Mängel zu vergessen; zuweilen war er wahnsinnigen Wutausbrüchen unterworfen, für gewöhnlich aber stand er auf bestem Fuße mit all und jedem.
Als er siebzehn Jahre alt war, fiel sein Vater von einem Heuschober und brach sich das Genick. Von da an lebten Mutter, Tochter und Sohn zusammen auf dem Hofe, gelegentlich mal durch laut jammernde, von Eifersucht eingegebene Besuche des Schlachters Frank aufgestört, der einen Groll gegen die ganze Welt gefaßt hatte, weil sie ihm stets weniger als seinen gebührenden Anteil zukommen ließ. Besonders gegen den jungen Tom war Frank eingenommen, den er ein verzogenes Kröt nannte, und Tom erwiderte diesen Haß voller Heftigkeit, sein Gesicht rötete sich und seine blauen Augen begannen starr zu werden. Effie schlug sich dann auf Toms Seite gegen Frank. Wenn aber Alfred aus Nottingham kam, mit dem dicken Unterkiefer und von unten auf schulend, einsilbig, aber seine Angehörigen mit einer gewissen Verachtung behandelnd, dann stellten Mutter und Effie sich auf seine Seite und schoben Tom in den Schatten. Es ärgerte den Jungen, daß die Weiber aus dem älteren Bruder eine Art Helden machten, bloß weil er nicht zu Hause lebte und so'n Spitzenzeichner und beinahe ein feiner Herr war. Aber Alfred war eine Art gefesselter Prometheus, so liebten die Weiber ihn. Später lernte Tom seinen Bruder besser verstehen.
Читать дальше