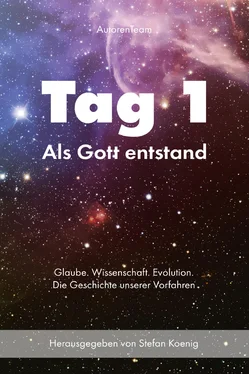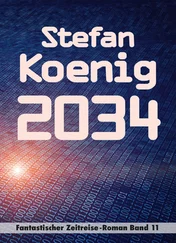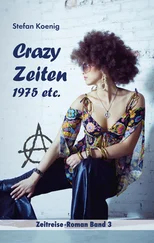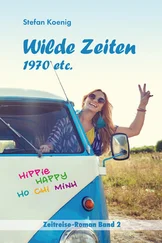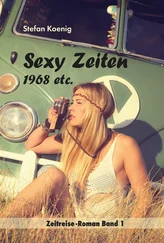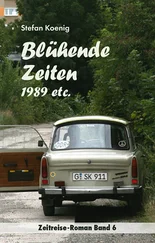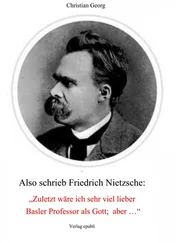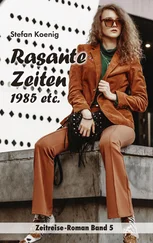Im Meer aber sind alle Wellen gleich und veränderlich. Wie soll man da nicht den Weg verlieren, wenn unten nur das blaue Meer, oben nur der blaue Himmel ist? Nach unten blicken ist zwecklos. Und der Seefahrer errät, dass er nicht nach unten, sondern nach oben blicken muss. Er schaut nach oben, und dort, bei den Sternen, sucht er die Zeichen und Kerben, die ihm den Weg weisen sollen. Mittags führt ihn die Sonne nach Süden. Nachts weist ihm der Kleine Bär den Weg nach Norden. Nicht umsonst nannten die Phönizier den Kleinen Bären den „Wagen“. Das ist das Gestirn der Fahrenden und Reisenden.
So bemächtigte sich der Mensch seines Planeten, indem er die Sonne und die Sterne beobachtete. Er suchte die Schlüssel zur Welt – und fand sie im Makrokosmos der Gestirne.
Einstmals trennte das Meer die Völker. Nun aber vereint es sie. Zugleich mit Schalen, Gewürzen, Geweben, Sklaven wandern fremde Sitten, Religionen und Gebräuche und fremde Meisterschaften übers Meer. Aus Ägypten nach Phönizien, aus Phönizien nach Griechenland wandert die Schrift, sie verändert sich unterwegs, aus Bildern werden Buchstaben. Auf jedem phönizischen Schiff befindet sich ein Schriftkundiger, der die Listen führt und die Abrechnungen macht. Er wird in der Heimat dem Herrn des Schiffes und der Waren genaue Rechenschaft ablegen müssen.
Die phönizischen Galeeren tragen nicht nur die starken palästinensischen Weine und die Purpurgewänder Sidons aus Asien nach Europa, sondern auch die Buchstaben des ersten Alphabets der Welt. In den europäischen Sprachen sind folgende phönizische Worte, leicht abgewandelt, erhalten geblieben: Galeere, Wein, Chiton, Alphabet.
Völker gingen unter, Throne stürzten, in den Flammen der Feuersbrände zerfielen die Papyrusrollen zu Asche. Die Buchstaben aber verschwanden nicht. Sie gingen durchs Feuer, ohne zu verbrennen. Selbst die Zeit schien keine Macht über sie zu haben. Der Mensch hatte keinen größeren Reichtum als diese wenigen Buchstaben. Durch eine leichte, aber feste Brücke verbanden sie Völker und Jahrhunderte. Wären sie nicht gewesen, wessen Gedächtnis hätte das fassen können, was der menschliche Geist im Laufe der Jahrhunderte geschaffen hatte? Für den, der sie beherrscht, hat das Gedächtnis keine Grenzen. Mit ihrer Hilfe lassen wir längst versunkene Welten auferstehen, sehen wir, was nicht mehr ist, hören wir die Worte längst verstummter Münder. Umso bedauerlicher ist es, wenn heute viele derjenigen, die sich kraft ihrer religiösen Überzeugungen für die Geschichte der Religionsentstehung interessieren sollten, keinerlei Bezug zur Evolutionsgeschichte finden wollen.
Von Volk zu Volk, von Generation zu Generation wandern die Buchstaben, sie vereinigen die Lebenden und die Toten, die Nahen und die Fernen zu einer einzigen, (hoffentlich) ewig lebenden Menschheit.
Doch kehren wir zurück zu den phönizischen Seefahrern. An einer fremden Küste gelandet, senden die Seefahrer zuerst Kundschafter aus. Man muss feststellen, was für Menschen hier leben: „Wilde, die keine Gesittung kennen, oder solche, die die Götter ehren.“ Oft kommt es vor, dass die Eingeborenen die Gäste mit einem Hagel von Speeren und Pfeilen empfangen. Das ist den Ankömmlingen eine Lehre. Das nächste Mal sind sie vorsichtiger. Sie breiten ihre Waren am Strand aus und machen ein Feuer an. Sie selber aber stoßen ab und fahren zurück aufs Meer.
Auf den Rauch hin nähern sich die Eingeborenen vorsichtig dem Ufer, nehmen die mitgebrachten Gaben und lassen selber Gaben für die Gäste zurück.
So begegnen Menschen einander, wie Unsichtbare, und sehen sich nicht von Angesicht. Mag sein, dass den Eingeborenen die Seefahrer wie unbekannte Götter vorkommen, denen sie Gaben opfern sollten.
Doch wenn die Kaufleute an Küsten anlegen, wo man sich schon kennt, spielt sich alles ganz anders ab. Sie ziehen die Galeere auf den Strand und legen an Deck ihre Waren aus, wie auf einem Ladentisch. Die Frauen umdrängen das Heck; oft kommt auch die Tochter des Landesfürsten mit ihren Gespielinnen.
Der Handel geht friedlich vor sich. Es kann aber auch geschehen, dass im letzten Augenblick, wenn die Ware ausverkauft ist, die Schiffe schon aufs Wasser gelassen werden, die tückischen Kaufleute sich in Räuber verwandeln und die Käuferinnen in … Ware. Man packt die Frauen und trägt sie aufs Schiff. Auf ihre Hilfeschreie läuft das Volk zusammen, doch es ist schon zu spät. Der günstige Wind bläht das weiße Segel, die Mannschaft wirft sich in die Ruder.
Das Schiff entfernt sich, es wird kleiner und kleiner.
Die Mütter weinen und zerreißen ihre Kleider. Die alten Frauen trösten sie: „Es ist wohl der Wille der Götter, wenn selbst die stolze Tochter des Fürsten die Bitternis der Gefangenschaft auskosten muss.“
Starten wir die zehnte Vorlesung. Segeln wir gemeinsam mit den Welterkundern vor rund dreitausend Jahren über die Meere.
Eine neue, riesige Welt öffnet sich den Menschen, eine Welt voller Geheimnisse und Wunder. Man braucht nur an einer fremden Küste anzulegen, und schon ist man in einem Märchenland. In dieser neuen Welt verstehen die Ankömmlinge nur schwer, was ihre Augen sehen und ihre Ohren hören. Die fremde, unverständliche Sprache scheint ihnen wie das Piepsen der Fledermäuse und das Zwitschern der Vögel. Den hohen Berg halten sie vielleicht immer noch für eine Säule, die den Himmel stützt.
Als sie das erste Mal große Affen sehen, glauben sie, das seien behaarte Männer und Frauen. Diese behaarten Menschen kratzen und beißen, wenn man sich ihnen nähert. Einen Steppenbrand an der Küste halten sie für einen breiten Feuerfluss, der sich ins Meer ergießt. Um die neue Welt zu durchdringen, musste der Mensch selber anders, neu werden. Er musste sich Ruder- und später Segelfahrzeuge schaffen und lernen, mit ihnen die Wellen zu überqueren.
Er machte sich die vier schnellen Füße des Pferdes und den höckrigen Rücken des geduldigen, zähen Kamels dienstbar. Das öffnete ihm die Tore zur Steppe und zur Wüste. Er kam in fremde Länder und sah, was er noch nie gesehen hatte. Doch nicht nur das Ungesehene zu sehen, auch das Unbegreifliche zu verstehen, war jetzt seine Aufgabe. Dies aber war schwerer als alles andere.
Der Mensch misst doch meistens alles mit seiner Elle, dem alten, gewohnten Maß, das er von seinen Vätern und Vorvätern übernommen hat. Wenn er etwas Neues sieht, sucht er zuerst das Alte darin. Und wenn er das Alte, Vertraute nicht findet, wird er verwirrt und versteht nicht mehr, was er sieht.
Einst dachten die Ägypter, ihr Fluss sei der einzige der Welt. Dieser Fluss floss von Süden nach Norden, und so glaubten sie denn, anders könne es gar nicht sein. Wenn sie „Norden“ schreiben wollten, zeichneten sie ein Schiffchen, das ohne Segel mit der Strömung trieb. Um „Süden“ auszudrücken, machten sie ein Schiffchen mit Segel, das gegen die Strömung fuhr.
Dann aber verließen sie ihre enge Heimat. Sie erblickten andere Flüsse, sie kamen bis an den Euphrat. Und es erwies sich, dass der Euphrat keineswegs wie ihr heimatlicher Strom floss: nicht von Süden nach Norden, sondern von Norden nach Süden. Diese Entdeckung verwunderte die Ägypter dermaßen, dass sie beschlossen, sie für ewige Zeiten zur Belehrung der Nachkommen aufzuzeichnen. Auf Befehl des Pharao Thutmosis I. wurde auf einem steinernen Grenzpfahl eingeritzt, dass „das Wasser des Euphrat sich rückwendend stromaufwärts“ fließe.
Vieles setzte die Ägypter in Verwunderung, sobald sie sich jenseits der Grenzen ihrer gewohnten Welt – im Makrokosmos – befanden. Sie waren daran gewöhnt, dass der Fluss ihre Felder berieselte. In Ägypten ist Regen äußerst selten. Und ohne die Überschwemmungen des Nils hätte sich das Land schon längst in eine Wüste verwandelt. Doch nun waren sie in fremden Ländern gewesen und hatten dort zu ihrem Erstaunen gesehen, dass die Felder nicht vom irdischen Nil, sondern von einem himmlischen Nil bewässert wurden, womit sie den Regen bezeichneten. Für uns ist der Regen die allergewöhnlichste Sache. Für sie aber war er ein wunderbarer Fluss, der vom Himmel niederstürzte.
Читать дальше