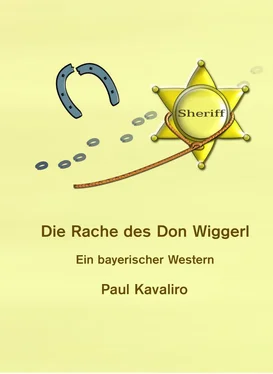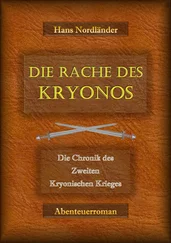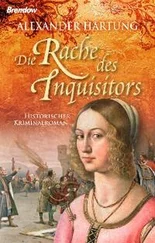Und Semis Geschichte sollte Ludwig erst im Laufe der Zeit erfahren. Zum Beispiel, dass sich keiner hier richtig vorstellen konnte, wie es dort aussah, wo Semi herkam, außer die Behörden. Aber dass viele, die ihn sahen, hofften, dass er schnell wieder dorthin zurückkehrte, von wo er gekommen war, damit er hier keine kostbaren Steuergelder kostete.
Der junge Nordafrikaner wollte seinerseits niemandem auf der Tasche liegen. Zum Glück gestand ihm die Ausländerbehörde die Erlaubnis zu Aufenthalt und Arbeit zu – er konnte damit einer bezahlten Tätigkeit nachgehen. Also machte er sich auf Jobsuche. Aber ohne anerkannte Ausbildung und ohne Referenzen war das kein Zuckerschlecken. Wählerisch konnte man jedenfalls nicht sein. Semi fand hier und da eine Gelegenheit, zum Tellerwaschen, zum Schneefegen. Dass er dabei stets freundlich auftrat, milderte das Vorurteil des Schmarotzertums im Weltbild der Ausländer-Kritiker nicht. Er bewies mit seiner Fröhlichkeit nur seine Niedrigkeit in den Augen der kritischen Alteingesessenen. Doch zum Glück gaben sich nicht alle abschätzig, sondern manche auch offen.
Der Bürgermeister Moritz Hofmann zum Beispiel hatte ihn in der Gemeinde willkommen geheißen und hatte sich sogar schon einmal mit ihm für die Zeitung fotografieren lassen. Er wollte schließlich nicht als weltverschlossener Lokalpatriot dastehen in Zeiten, in der die deutsche Bundespolitik Weltoffenheit die Parole war. Manch einer hielt Hofmann deswegen für einen Gutmenschen. Nun, das war er nicht, denn er stürzte sich nicht blindlings in unkalkulierbare Abenteuer, wie er manchmal am Stammtisch hinter vorgehaltener Hand in Richtung besagter Bundespolitik grummelte. Der bayerische Widerspruchsgeist ließ grüßen.
Doch ein einzelner Nordafrikaner in der Gemeinde stellte kein Abenteuer dar. Er wirkte nicht unkontrollierbar wie eine Horde namenloser Zuagroaster. Er hatte einen Namen und ein Gesicht. Und er war freundlich. Also blieb Moritz Hofmanns stolze Seite erhaben über die Gutmenschen-Unterstellungen.
Seine vorsichtige Seite hingegen hatte Angst, dass sich wegen eben diesem Semi Baccar eine gegen ihn, den Bürgermeister, gerichtete „Alternative für Genglkofen“ formierte oder – da sprechende Abkürzungen im Trend lagen – gar die „Papagenos“: die „ Patriotischen Parteinehmer gegen Nomaden“.
Ausländer stellten ein Spiel mit dem Feuer für einen gewählten Volksvertreter dar. Und Moritz Hofmann drückte sich selbst die Daumen, dass er sich im Umgang mit ihnen nicht die Finger verbrannte.
Ludwig ahnte von alledem nichts. Es hätte ihn auch kaum gekümmert. Generell interessierte ihn Politik wenig. Sie kam oft wechselhaft daher; dabei war es ihm am liebsten, wenn sich nicht viel änderte und die Dinge einfach blieben, wie sie waren. Bei seiner Tochter Callista lief das ganz anders. Doch jetzt nicht abschweifen. Zurück zur Sache, Ludwig!
Das Einzige, was ihn also am heutigen Nachmittag kümmerte, war die Frage, ob dieser Semi auf den Job passte und ob er ihm eine Chance geben sollte. Als er nach dem Einkauf aus dem Markt kam, war der Vorplatz ordentlich geräumt und kein Schnee zum „Fertigmachen“ mehr da.
„Gediegen“, dachte sich Ludwig.
Dennoch, einen Deutschen aus echtem Schrot und Korn hätte er als Helfer-Kandidaten bevorzugt. Mit denen konnte man reden, in gemeinsamer Sprache, ohne Missverständnisse. Die vertrugen auch mal ein hartes Wort, da musste man nicht ständig auf kulturelle Besonderheiten achten. Redewendungen, die hierzulande im Alltagsleben ganz normal vorkamen, die verstand ein heißblütiger Südländer eventuell anders und womöglich noch falsch und zückte innerlich das Messer.
Bei diesem Gedanken musste Ludwig fast schon über sich lachen. Er hatte doch selbst lange jenseits des Großen Teichs gelebt – als Ausländer.
Dennoch, eine unsichtbare Wand zwischen ihm und dem Dunkelhäutigen blieb. Ludwigs Reserviertheit stellte sie auf und sein Misstrauen hielt sie fest, damit sie nicht einstürzte. Dieser Typ musste sich erst Ludwigs Vertrauen verdienen.
Der Afrikaner spürte das Vorurteil, aber das ging ihm bei vielen Deutschen so. Die trugen ihr Herz eben nicht auf der Zunge. Das war schon OK. Und Freunde müssten dieser Luhtwich und er nicht werden. Das war gar nicht notwendig. Semi befand sich heute nicht auf der Suche nach innigen Freunden, er befand sich auf der Suche nach Arbeit. Und etwas, das länger als eine Stunde Anstrengung auf dem Supermarkt-Vorplatz dauerte und das regelmäßiger abgerufen und bezahlt wurde, das erschien ihm attraktiv.
Und so erwartete er den mit Einkäufen beladenen Ludwig ein paar Meter von der Supermarkttür entfernt. Er bot ihm an, etwas abzunehmen, was der aber abwehrte. Aber dass er ihm die per Fernbedienung entriegelte Jeep-Tür öffnete, das nahm Ludwig an.
Mitdenken konnte dieser Junge also, nahm Ludwig mit Genugtuung zur Kenntnis. Also erzählte er ihm während des Auto-Einladens davon, dass er Hilfe bei einer Überwachung benötigte und außerdem noch bei der Spurensuche.
„Und wo? In einer Fabrik?“, fragte der Nordafrikaner aufgeregt.
Siehe da, er interessierte sich. Ludwig erzählte ihm von der Ranch, von den verschwundenen Pferden. Und das ohnehin schon übernatürliche Leuchten im Gesicht von Herrn Baccar, in dessen Inneren sich tausend Danksagungen an die Agentur für Arbeit entluden, die diesen Luhtwich zu ihm geführt hatte, wurde noch heller.
„Kann ich Sie zu Kaffee einladen?“, fragte dieser Semi jetzt doch tatsächlich und winkte mit dem Kopf in Richtung Bäcker-Theke drüben am Supermarkt-Eingang.
Der wirkte echt ein bisschen aufdringlich; aber warum nicht, dachte sich Ludwig und willigte ein: „Na gut, aber den Kaffee zahle ich.“
Das nordafrikanische Leuchten bei den Stichwörtern „Ranch“ und „Pferde“ hatte einen einfachen Grund: Es war der Anlass, den die Agentur erfasst hatte und der Ludwig und den tunesischen Zuagroasten per Stichwortsuche zusammenbrachte: Semi hatte selber als Pferdehalter gearbeitet, erzählte er. In seinem früheren Leben, im Heimatland. Er verlieh die Tiere für Reitausflüge an Touristen. Damit sammelte er Geld und außerdem Sprachkenntnisse, vor allem Deutsch. Damit hatte er hier in Deutschland gleich eine gute Basis und ein Sprachkurs weitete sie noch aus.
Obwohl Ludwig die Herkunft seines Gegenübers bereits von der Arbeitsagentur erfahren hatte, zog er unwillkürlich die Augenbrauen hoch, als der Name des Heimatlandes während ihrer Unterhaltung fiel.
Der Afrikaner las Ludwigs Gedanken. Ja, in Tunesien gab es viele Menschen und darunter gab es eben auch Verirrte – Terroristen, die alles kaputtmachten. Sie hatten ihren Opfern und ihrem eigenen Land viel Schaden zugefügt.
Und das Bild des Tunesiers in Europa prägten vor allem die Terroristen, die am tunesischen Strand die Urlauber erschossen und die in Berlin Leute überfuhren. Die Tunesier jedoch, die sich am Strand schützend zwischen die Terroristen und die ausländischen Gäste gestellt hatten und sagten, man solle doch lieber sie anstelle der Urlauber erschießen, die verblassten in der kollektiven europäischen Erinnerung und von denen sprach keiner mehr. Gewalttäter bildeten nicht das wahre Gesicht des Landes. Semi wollte stattdessen dieses Gesicht sein und er versuchte, das Ludwig zu erklären, so gut er es vermochte.
„Verstehe“, bestätigte Ludwig kurz. Seine Bedenken gegenüber dem Fremden hatten sich inzwischen gelegt. Dieser Mann hier vor ihm sah nicht wie ein Gewalttätiger aus, auch konnte man mit ihm reden und außerdem war Ludwig groß und in der Lage, mit anderen Erwachsenen umzugehen, auch wenn sie aus einem fremden Land kamen. Darauf besann er sich jetzt, als der Afrikaner sprach. Ludwig schlürfte seinen Kaffee, während Semis Gefahr lief, kalt zu werden, weil er so aufgeregt war und viel erzählte.
Читать дальше