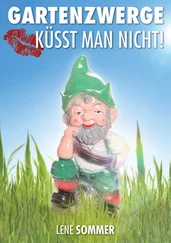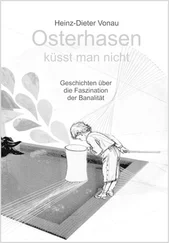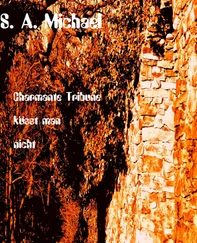Ich fragte Tante Maria, warum sie mir nicht zuhörte, wenn ich was aus meinem kleinen Leben erzähle. Doch sie verstand mich nicht; wie sollte sie? Sie hörte ja nicht zu. Stattdessen wurde sie böse und zischte, dass ich ein fürchterliches Kind sei. Meine Mama sah mich währenddessen traurig an und schwieg.
Obwohl sie Schwestern sind, mögen sich die beiden nicht sonderlich. Keine Ahnung warum. Ständig versuchen sie sich zu übertrumpfen, egal ob Kuchen, Salat oder Calamar a la Plancha. Immer will eine besser sein als die andere. Warum Mama sich darauf einließ, verstand ich nicht.
Mama war schön und elegant. Ihre Schwester dagegen klein und dick, konnte Einweckgläser mit bloßen Händen aufschrauben und trug einen leichten, aber schon sehr struppigen Oberlippenbart.
Damals glaubte ich, Erwachsene haben ihren Kopf nur, um sich Rezepte und Fernsehprogramme zu merken. Sie stritten oft über meine Schweigsamkeit. Aber der Reihe nach.
Weil niemand zuhörte, erfand ich die Wortfalle, um zu sehen, ob sie mir folgten. Wenn sie versuchten, mir zwanzig Sekunden Aufmerksamkeit zu schenken, baute ich in meinen Satz ein Wort, das mit dem Rest nichts zu tun hatte. Ungefähr so:
„Gestern habe ich mich mit Antonia beim Kugelschreiber getroffen.“
Schnell war ich traurig. Niemand merkte was. Dann fing ich an Fragen zu stellen. Sogar meine Stimme hob ich am Ende, um die Fragezeichen mit Schwung in den Boden zu rammen: Nichts. Rein gar nichts.
Ich fragte mich, warum ich was erzählen soll, wenn sie ständig wegschauen und mit anderen reden.
Für mich war dieser Tag mein Erwachen, meine Stunde Null. Wortlos stand ich auf und hatte gerade den Griff für die Tür zum Garten in der Hand, als mich Tante Maria anschrie, wo ich hinwolle.
Zuerst lächelte ich. Dann erwuchs aus meinem schüchternen Lachen ein immer größer werdendes Gekicher. Hatte Tante Maria vergessen, wo ihre Küchentür hinführte?
Ich konnte einfach nicht aufhören zu lachen. Plötzlich sprang Tante Maria auf, riss den Stuhl um, schmiss ihre schmutzige Schürze in die Ecke und rannte los.
Tante Maria lebt in so einem Körper, der einem Kartoffelacker gleicht, der übersät ist von Beulen und blauen Flecken. Ständig bleibt er an Tischkanten hängen. Nicht dass sie ein ausladendes Becken hat, eines, das an Bahnhofsuhren oder Ähnliches denken lässt. Ihre Welt ist einfach anders. Geschwindigkeiten und Bewegungen sind nicht wichtig und nicht ihre Stärke.
Dazu kommt, dass sie sich wie eine Marionette mit Fäden aus Gummi bewegt; alles schlackert komisch herum; ständig prallt sie gegen alles, was ihr in den Weg kommt. Ich glaube, ihr Kopf weiß nicht, dass er Beine und Arme lenkt und ist daher ständig überrascht, wenn sich unter ihm etwas bewegt.
Ich gehe rückwärts aus der Tür, sehe, wie wenige Meter vor mir Tante Marias Hausschuhe gefährlich tief über den Boden schlurfen, schätze ihren Weg ab, gehe zwei weitere Schritte zurück, hinein in den Garten, sehe die Länge ihrer behaarten Arme, bleibe stehen und warte. Mama schreit, Tante Maria läuft.
Wie erwartet bleibt sie an der Türkante hängen, hebt ab, fängt an zu fliegen und merkt mit überraschtem Gesicht, dass der Boden dichter kommt, während ich meine Grabschis in die Taschen stecke und den wütenden Haarknoten anlächle, wie er in Zeitlupe tiefer und tiefer sinkt und dumpf klatschend in einer curryfarbenen Staubwolke zu Boden geht, während sich ihre schluchzenden Finger im Sand eingraben und ihre des Nachts unter Tränen hastig abgekauten Fingernägel meine Schuhe streicheln.
Tante Marias Garten mündet in einen riesigen Olivenhain. Ein paar Bäume sehen aus wie versteinert. Manche sind viele tausend Jahre alt. Meeresluft streicht über die Berge, schiebt wütende Wolken aus Staub, Tannnadeln und vertrockneten Olivenbaumblättern vor sich her. Ehrfürchtig gehe ich zu einem alten Olivenbaum; wie ein Märchentroll sieht er aus; ich setze mich auf einen der knorrigen Äste und sehe dem Wind zu, wie er kleine weiße Schaumkronen aufs Mittelmeer zaubert.
Wind fährt mir durchs Haar, salzig, frisch und blau; gerade sehe ich den weißen Tupfern zu, wie sie das lange Haar der Wellen kämmen, als ich plötzlich ein Vibrieren spüre. Wo kommt es her? Es wird immer mehr; ich bekomme eine Gänsehaut und höre einen tiefen samtigen Ton, leichtfüßig, wie eine gewaltige Flöte.
Wieso können Bäume, die sich langsam bewegen und wenig reden, schöne Musik machen, während meine Tante weder gehen, laufen und schweigen kann, ohne die Welt zu zerstören und mit schmierig dumpfer Schimpfkloake zu überziehen?
Schnell fing ich an, den Baum zu mögen und besuchte ihn regelmäßig, besonders dann, wenn Erwachsene mir komische Geschichten auftischten.
Mit der Zeit wurde ich älter und bin selber ein Erwachsener geworden. Doch die Baumorgel gibt es immer noch; noch heute höre ich sie, wenn Menschen sich verlieren und mich zu Tode langweilen; dann summt sie sanft und ich lächle wie ein kleines Kind, das die Welt gar nicht mehr so schlimm findet.
Hamburg, Stadt der Stürme
Raketen schießen links und rechts in den Himmel; Menschen rennen kopflos in einer Wüste umher; Bauwagen auf kargem, trockenem Sand; ich sehe zwei Ex-Freundinnen vorbeirennen; tiefes Grollen, ohrenbetäubendes Donnern, von tief unten, als wenn der ganze verfluchte Erdkern explodiert. Atompilze schießen in die Höhe. Druckwellen rollen ran; Kreaturen schreien.
Wir rennen zu einem Bauwagen, schmeißen uns darunter, feuchte Tücher vor Gesichter haltend; öffnen den Mund zum Druckausgleich; staubig donnert die Druckwelle ran, fegt über uns hinweg, Baubude, Bäume, Sträucher, alles mit sich reißend.
Vom Blitz getroffen reiß ich die Augenlider auf; ich bin nassgeschwitzt; ein Scheißtraum. Meine Augen sind noch matt, als ich aus dem Fenster sehe; ich denke an die letzten Wochen. Wie sehr liebe ich meine Heimat mit ihren Olivenbäumen und Schafen. Schon lange rumorte es in mir. Du musst nach Hamburg, Heimatstadt deiner Mutter.
„Ja, ja, ich bin doch unterwegs!“, beruhige ich die Götter.
Doch ich habe ein Problem. Ich schreibe Geschichten. Ich bin der Meinung, es auch von Hamburg aus machen zu können. Und dann habe ich Glück: Meine feudale Redaktion glaubt das auch. Sie ist einverstanden, unter der Voraussetzung, dass meine Beiträge weiterhin pünktlich kommen und ich mich hin und wieder blicken lasse.
Skepsis kriecht in mir hoch. Liegt es an Deutschland? An Hamburg? Ist das Pflaster so rau? Oder bin ich ein Sonderling, der nicht überlebensfähig ist? Ich zögere nicht lange und frage Laetitia, die Chef-Redakteurin.
„Wieso ist das wichtig, mich im Ganzen zu sehen? Ich kann anrufen, oder eine Nachricht schicken; ich mache doch kein Urlaub im Gulag“, und runzle die Stirn.
„Weil ich dich kenne, Guapo; du bist ein Grenzgänger, probierst alles aus. Meist ist das zauberhaft, aber wir beide wissen, warum dein Leben ist, wie es ist.“
„Ich weiß“, entgegne ich und sie hat Recht. Na toll.
„Entweder wird dein Besuch in Hamburg kurz, oder sehr lang. Wenn du begeistert bist, gibt es keine Grenzen; und jetzt hau ab, bevor ich heule, Puta Allemanna, Bastardo di Mierda!“
„Amore, ich komme wieder, ganz bestimmt.“
Schnell stehe ich auf und werfe ihr den Kuss nur zu, da sie anfängt zu schluchzen und ich Prügel riskiere, wenn ich sie in den Arm nehme. Beeindruckend, und steinerweichend, wenn sich stolze Frauen öffnen, ihre Verletzlichkeit zeigen.
Ich schlafe bestimmt 100 Minuten und werde gerade wach, als der Kapitän Turbulenzen ankündigt. Wir sollen uns anschnallen; wie rücksichtsvoll. Gelangweilt sehe ich raus und schaue dem neblig-nassen Teppich zu, wie er sich beharrlich weigert Licht durchzulassen. Was für eine elendig trübe Suppe.
Dann schüttelt es uns mächtig durch. Zwei Mädels neben mir reden ohne Pause. Die Windböen toben dafür immer stärker. Ich fange an zu lächeln. Langsam ist es still im Flieger. Im ersten Leben muss der Kapitän Cowboy gewesen sein. Brennender Eifer lässt ihn die Maschine durch das boshafte Wetter reiten.
Читать дальше