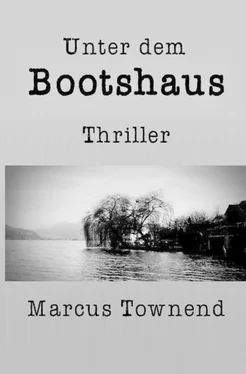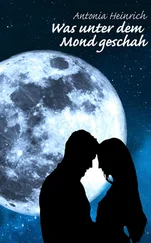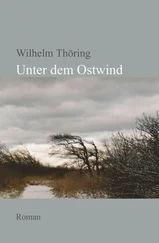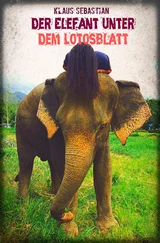Seine Kindergärtnerin spürte den Hunger des Jungen nach elterlicher Zuwendung und sie befürchtete, dass sich seine Mutter wegen des Aussehens ihres Sohnes schämte. Die Pädagogin konnte jedoch keine Beziehung zu seinen Eltern herstellen, was eine Voraussetzung dafür gewesen wäre, ihm helfen zu können. Sie blieben allen Eltern- oder Schulveranstaltungen fern.
Mustafa bewunderte und fürchtete seinen Vater. Dieser schien alles zu wissen, alles zu können und niemals Fehler zu machen. Er schien ihm geistig unerreichbar, emotional unnahbar. Er war sein grosses Vorbild, gleichzeitig aber auch Ursache heftiger Gefühle.
Den Grund für den väterlichen Liebesentzug und die mütterliche Abneigung suchte er bei sich selbst. Seine schlechten Zeugnisse und sein ständiges Sich-mit-sich-selbst-Beschäftigen mussten für seinen Vater eine endlose Enttäuschung sein. Mila fühlte sich von den plötzlichen Wutausbrüchen, seinen ungezügelten Essanfällen und dem Chaos, das er überall hinterliess, überfordert. Er empfand ihren Ekel vor seinen immer wieder erscheinenden Rötungen und Ekzemen als gerechtfertigt. Trotzdem begann er seine Mutter zu hassen.
Mustafa war ein unbeständiger Schüler. Er konnte sich nur für kurze Zeit auf den Lernstoff oder seine Lehrerin konzentrieren. Bald schweiften seine Gedanken ab und er begann etwas zu zeichnen oder aufzustehen, um auf die Toilette zu spazieren. Sein Kopf war gefüllt mit sprunghaften Ideen, Bildern und Tönen, sodass er oft abwesend und unbeteiligt wirkte. Er war kleiner als die meisten seiner Klassenkameraden und ab der 3. Klasse übergewichtig. Bisweilen wurde er verprügelt. Aus Langeweile, oder weil er sich nie wehrte. Mustafa weinte nie. Schon bald begann er, sich immer mehr zurückzuziehen, niemanden auf die Insel einzuladen. Er schloss und pflegte keine Freundschaften. Das führte nicht dazu, dass seine Klassengespanen ihn übermässig plagten, hänselten oder auslachten. Sie erlebten ihn eher als etwas Fremdes, das sie ignorieren wollten. Aus Trotz gegen diese Ablehnung vernachlässigte er seine Körperpflege und begann zu stinken. Dadurch wurde Mustafa immer mehr von sportlichen Anlässen, Schullagern oder Einladungen ausgeschlossen. Er schämte sich, wenn er wegen seiner Hautkrankheit errötete und sich aufgrund seines stetigen Kratzens blutende Wunden ergaben. Dies besserte sich eines Tages, nachdem Folgendes geschehen war:
Er befand sich zusammen mit seiner Mutter im Garten. Es war ein heisser Nachmittag im Sommer und so fand Mustafa einen Platz unter einer grossen Weide, welche Schatten und Kühle spendete. Nach einer Weile schlief er ein. Als er erwachte, erschrak er: Auf seinem nackten Oberarm befand sich eine Schnecke. Sie musste über seinen Handrücken den ganzen Unterarm hinaufgekrochen sein. Mit heftigen Bewegungen seiner Hand versuchte er sie abzuschütteln. Als er sie an ihrem Häuschen fasste, gelang es ihm. Der Junge stand auf und trat auf sie ein und schrie drei Mal: «Tot!». Er hatte kein sauberes Taschentuch dabei, mit welchem er die Schleimspur, welche sie auf ihrem Weg hinterlassen hatte, abwischen konnte.
Dieses Erlebnis hatte zur Folge, dass sich überall auf seiner Haut Ekzeme gebildet hatten. Ausser auf einem schmalen Streifen, dort wo sich die Schnecke fortbewegt hatte. Am nächsten Tag suchte er nach einer Schnecke, die so aussah, wie die vom Vortag. Bald fand er eine, bei welcher es sich, wie er später herausfand, um eine Gefleckte Weinbergschnecke handelte, welche mit der grösseren Weinbergschnecke verwandt war. Mit Hilfe einer Lupe, Sonnenlicht und viel Geduld entdeckte er am vorderen Ende des Kopfes Öffnungen, welche einen Ausfluss absonderten, über den die Schnecke kroch. War es dies, was eine Rötung seiner Haut zu verhindern schien? Er nahm den Schleim zwischen Zeigefinger und Daumen und rieb. Er wirkte elastisch wie seine Kaugummis. Als er seine Finger spreizte, wurde der Schleim flüssig.
In den nächsten Tagen und Wochen bastelte er eine kleine Umzäunung, welche er vor allen, die auf der Insel lebten, versteckt hielt. Dann begann er Schnecken zu sammeln und stellte sie in sein Tiergehege. Nach einiger Zeit konnte er eine kleine Zucht sein Eigen nennen. Seine Selbstbehandlung begann jeweils damit, dass er sich auszog, sich auf den Rücken legte, um dann während einiger Stunden mehrere Schnecken auf seinem Körper herumkriechen zu lassen. Ihm schien, dass er weniger schuppende und nässende Ekzeme bekam und der Juckreiz nachgelassen hatte. Und er fühlte sich entspannter und selbstsicherer.
Auf der Insel befanden sich zahlreiche Skulpturen aus Stein, Eisen oder Holz. Sie säumten die kurzen Wege, standen manchmal aber auch isoliert herum. Die Wohnung im Bootshaus war gefüllt mit antiken Möbeln und Gemälden aus verschiedenen Epochen. Für Milas Empfinden war diese, für sie überreiche Sammlung von Kunstgegenständen, weniger ein Ausdruck von Kunstliebe. Sie sah darin mehr das Bedürfnis beider Männer nach reiner Zurschaustellung. Goran gab seiner Gattin genügend Geld, sodass sie sich vieles, das sie brauchte, selbst erwerben konnte. Trotzdem begann Mila, sich immer unwohler zu fühlen. Sie erlebte die Insel als Gefängnis, ihren wortkargen Gatten als Wärter. Auf das Festland durfte sie nur mit seiner Erlaubnis. Mila war am Ende ihrer Kräfte und ihres Lebenswillens. Mustafa war inzwischen elf Jahre alt und besuchte die fünfte Klasse. Als die Sommerferien vorbei waren, fasste sie einen Entschluss: Sie wandte sich an den reichen Inselbesitzer und bat ihn um Hilfe.
Hans Wyss war gerne dazu bereit, hatte er ihre Überforderung und den damit verbundenen Stimmungswandel schon vor langer Zeit wahrgenommen. Er erinnerte sich an seinen eigenen Aufenthalt in einem Internat, in welchem er die dreijährige Handelsschule besucht und mit einem Diplom abgeschlossen hatte. Die Platzierung Mustafas in einer Lehranstalt würde ihr erlauben, wieder zu Kräften zu kommen. Zudem würde es ihm den häufigen Anblick dieses unappetitlichen Jungen ersparen. Das Internat befand sich in der Zentralschweiz und war Teil eines ehemals von Mönchen geführten Kollegiums. Hans Wyss setzte sich mit der Schule in Verbindung.
«Kannten Sie Pater Pirmin noch?», fragte er einleitend, nachdem er mit dem Schulleiter verbunden worden war.
«Nein, leider nicht», antwortete der Angesprochene mit einem Basler Akzent, «aber ich weiss, dass Pater Pirmin ein wunderbarer Mensch und ein offener Rektor gewesen ist.» Dann fügte er aufgrund eines Geistesblitzes freundlich hinzu: «Somit müssen Sie in den 60er Jahren hier im Benediktinerkollegium gewesen sein.» Der jovial wirkende Rektor am Telefon hatte seine schwarz umrandete Wayfarer Brille abgezogen und sass zurückgelehnt in seinem Sessel, um sich von der letzten Sitzung, welche er mit einigen Lehrpersonen hatte, zu erholen. Er hatte trotz seines fortgeschrittenen Alters einen sehr wachen und offenen Geist bewahrt und er bemühte sich, sowohl für seine Lehrpersonen wie auch für alle Schüler und Schülerinnen eine offene und menschliche Ansprechperson zu sein.
«Ja, genau», sagte Hans Wyss, dann legte er ihm sein Anliegen vor. Dem Schulleiter, der sein letztes Amtsjahr als Rektor vor sich hatte, kam dieses Gespräch sehr ungelegen. Vor wenigen Tagen hatte ein in den Medien als Jahrhundertflut bezeichnetes Hochwasser, seine Kantonsschule überflutet. Da mehrere Gebäude stark beschädigt worden waren, musste eine Containersiedlung aufgestellt werden, damit der Schulbetrieb wieder in Gang gesetzt werden konnte. Er berichtete dem Anrufer ausführlich hierüber und drückte auf die Taste mit der Freisprechfunktion. Dann winkte er seinem Administrator, welcher auf der anderen Seite seines breiten Bürotisches sass, und dem Gespräch interessiert zuhörte. Er zeigte auf das Telefongerät und formulierte lautlos mit seinen Lippen: «Wer?» Hierauf fuhr er fort, dem Anrufer zu berichten, dass das Kollegi vor kurzem vom Kanton übernommen worden sei und nur noch sehr wenige Mönche im Kloster leben würden. Bevor er dazu kam, das Anliegen des Anrufers abzulehnen, unterbrach ihn der Industrielle:
Читать дальше