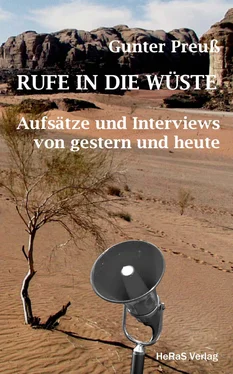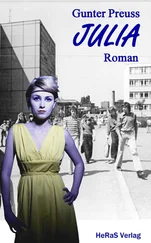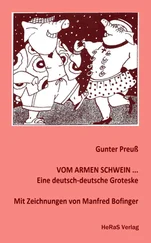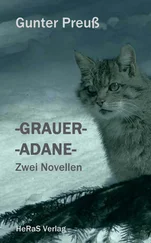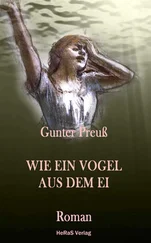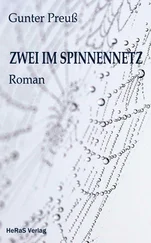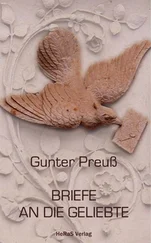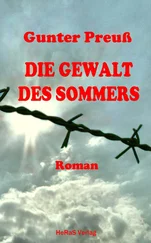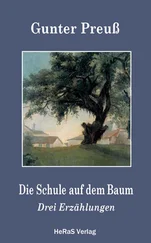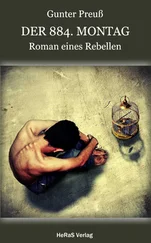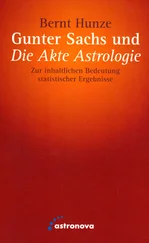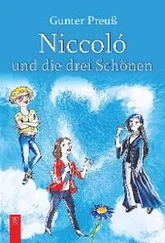Ich möchte Ihnen ein paar Zeilen aus meinem neuen Manuskript „Annabella und der große Zauberer“ vorlesen, um zu verdeutlichen, worauf ich vertraue. Gerade bei der wachsenden Sorge um den Bestand unserer Erde sollten wir doch hoffnungsvoll in die Zukunft blicken können. Es ist eine treibende Kraft in uns Menschen, tatsächlich etwas Göttliches, eine Kraft zur Wahrheit hin, durch nichts und niemand über einen langen Zeitraum aufzuhalten. Und da wir annehmen, dass Wahrheit zur Gerechtigkeit führt, und Gerechtigkeit zur Freiheit, und Freiheit zur Schönheit, sollen wir wissen, wo wir unsere Kraft lassen müssen, um frischen Mut zu gewinnen.
In der Schule störte Annabella den Unterricht. So meinte es Herr Ratzeburger. Der Lehrer las aus dem Lesebuch einen Zungenbrecher vor: Esel fressen Nesseln nicht, Nesseln fressen Esel nicht. Annabella sollte den Satz nachsprechen. Sie fragte: „Warum?“
„ Nein!“, rief Herr Ratzeburger. „Du mit deinem Warum!“
„ Warum?“, wiederholte Annabella.
„ Warum was?“, rief der Lehrer.
„ Warum fressen Esel Nesseln nicht? Und warum fressen Nesseln Esel nicht?“, fragte Annabella.
„ Warum?“, sagte Herr Ratzeburger leise. Dann rief er: „Warum, warum! Kannst du denn nicht einmal etwas so nehmen, wie es ist!“
„ Warum?“
Herr Ratzeburger steckte die Hände in die Hosentaschen, damit sie nicht den Kugelschreiber greifen konnten. Er versuchte zu lächeln. Er zwang sich, ruhig zu sagen: „Sprich mir nach, Annabella: Esel fressen Nesseln nicht, Nesseln fressen Esel nicht.“
Annabella sprach: „Warum fressen Esel Nesseln nicht? Warum fressen Nesseln Esel nicht?“
Herr Ratzeburger stöhnte. Seine Hände fuhren aus den Hosentaschen, er nahm hastig den Kugelschreiber, malte sein Gesicht blau und rief: „Tilo Rubinstein! Ich bitte dich: Sage du den Zungenbrecher richtig auf!“
Tilo Rubinstein sprach: Esel fressen Nesseln nicht, Nesseln fressen Esel nicht.“
„ Na also“, sagte Herr Ratzeburger erleichtert. „Eine Eins. Carola, du bist dran.“
Auch Carola bekam eine Eins für das Aufsagen des Zungenbrechers. Der Lehrer rief nacheinander alle Mädchen und Jungen auf. Schließlich sagte alle im Chor: „Esel fressen Nesseln nicht, Nesseln fressen Esel nicht.“
Aber Annabella konnte keine Ruhe geben. Sie wollte den Unterricht nicht stören. Aber von nun an war ihr „Warum?“ in jeder Stunde zu hören.
Annabella rief: „Warum will Jürgen von Erika drei Äpfel haben, wenn er schon sieben Äpfel hat?“
„ Das ist eine Rechenaufgabe, weiter nichts“, sagte der Lehrer. „Ich will das Ergebnis hören, nichts weiter.“
„ Aber“, sagte Annabella. „Jürgen hat vier Äpfel mehr als Erika. Warum will er dazu noch Erikas drei Äpfel haben? Erika muss von Jürgen zwei Äpfel bekommen. Dann hat jeder fünf Äpfel. Die können sie zusammen essen.“
Herr Ratzeburger vermied es, Annabella aufzurufen. Doch Annabellas Hand war immer oben. Und was sie alles wissen wollte: „Warum ...? Warum ...? Warum ...?“
12. „Warum?“ als Zauberformel (1986)
Das Gespräch führte: Ilona Rühmann
„ Annabella und der große Zauberer“ heißt ein Buch, das demnächst im Kinderbuchverlag Berlin erscheint. Es ist eins von der Sorte, die Kindern und Eltern gleichermaßen Vergnügen und Nachdenklichkeit bescheren können – sofern die Älteren den Jüngeren beim Lesen über die Schulter schauen.
Sein Autor, Gunter Preuß, erhielt in diesem Jahr den Alex-Wedding-Preis der Akademie der Künste für seinen Beitrag zur Kinder- und Jugendliteratur der DDR. Im Mittelpunkt seiner Bücher stehen oft Mädchen – als literarische Helden mit ungewöhnlichen Zügen.
Sie sind ein äußerst produktiver Autor. Warum haben Sie das Schreiben zum Beruf gemacht?
Angefangen habe ich mit idyllisierenden Kindergeschichten. Ich wollte der zerstrittenen Erwachsenenwelt eine freundlichere Welt entgegensetzen. Aber das half nicht, die Probleme zu benennen und vielleicht sogar aus der Welt zu schaffen. Nach eigenen bitteren Erfahrungen wurde Schreiben für mich zum Mittel, andere Menschen in ein lebenswichtiges „Frage- und Antwortspiel“ einzubeziehen.
Die Kinderliteratur in unserem Land verdankt ihren guten Ruf der Tatsache, dass sie jungen Lesern keine Extra-Welt anbietet, sondern die Welt zeigt, in der Kinder und Erwachsene miteinander leben. Ihre Kinderbücher sind Beispiele dafür. Sie schreiben auch für Erwachsene. Was machen Sie bei Kinderbüchern anders?
Erwachsene haben mehr Erfahrungen, für sie kann ich Probleme umfassender, zugespitzter, in größeren Zusammenhängen darstellen. In meinen Kinderbüchern ist die Welt nicht weniger kompliziert. Aber der gezeigte Wirklichkeitsausschnitt ist überschaubarer, ähnlich einer Kurzgeschichte, seine Gestaltung verlangt einesteils mathematische Genauigkeit und anderenteils die Freiheit der Poesie. Ich versuche ein Kinderbuch so zu schreiben, dass der Leser darin Fuß fassen kann und sich ein paar Schritte weiter in die Welt vorwagt, aber noch die Chance hat, sich darin zurechtzufinden.
Verständnis für die Seele eines Kindes zeichnet Ihre Bücher aus. Wie bewahren Sie sich das?
Das Kind, das jeder von uns einmal war, steckt wohl lebenslänglich in uns. Kindheit, als Zeit des Werdens und der Bewusstseinserweiterung, hat auch in der Literatur für Erwachsene enorm an Bedeutung gewonnen – ein exemplarisches Beispiel dafür ist Christa Wolfs „Kindheitsmuster“. So richtig wohl in unserer Haut fühlen wir uns anscheinend nicht, mit unserem Erwachsenwerden sind wohl durch Verletzungen auch hässliche Verwachsungen entstanden. Wir möchten wissen, wie das passieren konnte und lassen noch einmal das Kind sichtbar werden, dass wir über die Jahre in uns eingesperrt haben. Dem Künstler gestattet man noch am ehesten, seinen Spieltrieb, eine gewisse Naivität und seine ungebrochene Empfänglichkeit für alles Neue mit ins Erwachsensein zu nehmen. Ohne dieses kindhafte Vermögen die Realität mit der Fantasie zu erweitern könnte ich nicht schreiben. Ob ich aber als Erwachsener wirklich das Fühlen eines Kindes treffe, darin liegt für mich auch immer eine gewisse Unsicherheit. Und das ist wohl gut so, um nicht „liederlich“ zu werden.
Julia im gleichnamigen Buch wagt es, den erfolgreichen Klassenleiter in Frage zu stellen und gegen die ganze 8 b Partei für die neue Lehrerin zu ergreifen. In „Tschomolungma“ ist Peter vom höchsten Berg der Erde fasziniert, versagt aber vor dem alten Wachtturm, den jeder Junge der Klasse bereits bezwungen hat. Und die 14-jährige Luise in „Feen sterben nicht“ schreibt Briefe an die Märchenfee Scheherezade, weil sie verunsichert ist von den Veränderungen im Elternhaus, im Freundeskreis, in den eigenen Empfindungen. Sie begreift, dass das Leben nicht nur gut und schön ist und man nicht aufhören darf, nach anderen Menschen zu fragen. Immer wieder wenden Sie sich diesem Thema zu: Sie zeigen mit großem Einfühlungsvermögen junge Leute auf der Suche, auf dem Weg zu sich selbst, beschreiben das komplizierte Reifen von Persönlichkeiten.
Es reizt mich, die im Menschen versteckten Möglichkeiten zu einer selbstbestimmten Existenz zu gelangen, aufzuspüren und den Werdegang zu gestalten. Oft sind die verschiedenen Lebensansätze im Widerstreit. Daraus erwachsen für den Erzähler, der die Dramatik nicht ausschließt, durchaus reizvolle Probleme. Vor allem junge Leute, die noch nicht ausreichend reflektieren können, haben es mit dem inneren Widerspruch besonders schwer. Sie wollen am Althergebrachten rütteln und es womöglich umwerfen, sie wissen aber noch nichts Gleichwertiges oder gar Besseres dafür aufzubauen. Ausbruchsversuche und das Bedürfnis, bemuttert zu werden, wechseln einander ab. Die Umbruchphase zwischen Kind sein und Erwachsenwerden ist schon eine ganz besondere Konfliktsituation, die in ihrer Problemvielfalt prägend für den weiteren Lebenslauf ist. Das Thema beschäftigt mich immer wieder: Erkenne dich selbst, entwickle was dir gegeben ist, versuche nicht mit Macht, ein anderer zu sein.
Читать дальше