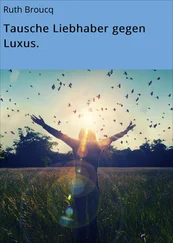Als ich den Spielraum betrat, konnte ich vor lauter Menschen kein bekanntes Gesicht entdecken. Auch auf den beiden oberen Etagen war ein solcher Hochbetrieb, dass ich mich regelrecht durchzwängen musste. Ganz anders als ich es von derartigen Amüsierbetrieben in Deutschland kannte, schien hier samstags jeder auszugehen.
Bert und Udo saßen in der Polsterecke. Nachdem ich mich dazu gesetzt hatte, entschuldigte sich Bert, er müsse Magdalena abholen. Dann ging er. Nun saß ich mit Udo alleine auf der Couch. Er spielte den Alleinunterhalter. Er würde sich freuen demnächst mit mir zusammen zu arbeiten, doch es wäre problematisch hier eine Wohnung zu finden. (Was wollte er damit andeuten?) Ich könne bei ihm wohnen, bis ich etwas passendes gefunden hätte. (Aha!) Ich bedankte mich für sein freundliches Angebot, lehnte aber energisch ab.
Verständnisvoll grinsend versprach er dann, sich in den nächsten Tagen mal für mich zu bemühen. Ich möge sein Angebot nur als kollegiale Geste, nicht als Annäherungsversuch sehen. Er könne verstehen, dass ich nicht zu ihm ziehen wolle. (War es möglich? Hatte ich ihn bisher verkannt? Man spielte den Samariter?)
Zu viert verbrachten wir dann ein paar wirklich schöne Stunden. Bert lud uns in ein elegantes japanisches Nobel-Restaurant ein. Dort hatten wir das Vergnügen zuzusehen, wie der Koch an unserem Tisch stehend, ein köstliches Mahl in elf Gängen zubereitete. Es war ein Erlebnis für Augen und Gaumen. Die ganze Zeremonie dauerte fast 4 Stunden.
Auf meinen Wunsch machten wir anschließend einen Abstecher zu dem Casino des Reutlingers. Ich hoffte ihn dort zu sehen. Der Laden war sehr gut besucht. Einige der Croupiers kannte ich. Der Reutlinger war nicht anwesend. Die Nacht wurde lang. Wir zogen von einer Lokalität zur anderen. Je weiter die Uhr auf Morgen rückte, umso mehr tranken die beiden Männer. Magdalena und ich wurden immer schweigsamer. Ihr passte der übertriebene Alkohol-Konsum der Beiden offensichtlich auch nicht.
Offenbar hatte Adalbert sich vorgenommen, Udo und mich wieder zusammenzubringen. Seine dementsprechenden Andeutungen wurden immer klarer. Für mich war es fast nicht mehr zu überhören. Da ich mit meinem zukünftigen Chef jedoch kein Streitgespräch anfangen wollte, schwieg ich einfach. Obwohl ich eigentlich noch bis zum nächsten Abend bleiben wollte, zog es mich von Stunde zu Stunde mehr nach Hause. Die Feier wurde mir immer unerträglicher. Konsequent erklärte ich nun meinen Begleitern, ich müsse nun weg. Da beide zu viel getrunken hatten um zu fahren, entschloss ich mich, ein Taxi zu nehmen. Vom Hotel bis zum Bahnhof wären es ja nur ein paar Schritte, die würde ich dann zu Fuß gehen. Bevor mir jemand widersprechen konnte, verabschiedete ich mich schnell.
Neun Uhr zweiunddreißig lief der Zug im Bahnhof unserer Stadt ein. Müde stieg ich in meinen Wagen und fuhr als erstes zu meiner Freundin. Zuerst wollte ich die Kleine sehen, ich hatte das Baby sehr vermisst. Da Rabea noch schlief musste ich mit der Begrüßung noch etwas warten. Liebevoll blickte ich, vor dem Kinderwagen stehend, auf das niedliche Ding. Sie war alle Mühen wert.
Bei einer Tasse Kaffee sitzend, fragte Annette, wie ich Franco erklären wolle, das ich ab nächste Woche eine Arbeit übernehmen wolle. Ich antwortete: am besten gar nicht. Ich müsse erst einmal abwarten, was das Gespräch mit ihm ergäbe. Schon jetzt fürchte ich mich davor. Nur konnte ich der Sache nicht ausweichen. Sollte es tatsächlich stimmen, dass er sich bei mir häuslich niedergelassen hatte, würde er mir nie erlauben, dass ich wegging. Auch nicht um zu arbeiten, das war mir klar. Obwohl es ihm eigentlich recht sein musste, dass ich seine angeblich so schlechte finanzielle Lage nicht noch belastete. Aber da er ja für seine Bequemlichkeit eine Frau brauchte, seine, aus welchem Grunde auch immer, im Moment nicht mit ihm zusammen sein wollte, würde er mich sicher als Ersatz benutzen wollen. Wie ich es bewerkstelligen konnte, meine Arbeitsstelle trotzdem anzutreten, war mir noch nicht klar. Also musste ich mich überraschen lassen, was nun passierte. Als Annette fragte, ob ich keine Angst vor ihm hätte, gab ich zu: große. Doch was nützte das? Ich musste da durch! Beladen wie ein Packesel mit Baby-Tragetasche und Gepäck stand ich dann klopfenden Herzens vor meiner Wohnungstür. Diese ließ sich jedoch nicht öffnen. Von innen steckte der Schlüssel. Auch das noch, dachte ich. Wenn ich ihn jetzt wachklingeln müsste, würde seine Laune nur noch schlechter werden. Was blieb mir übrig, anders kam ich nicht in meine eigene Wohnung. Als hätte er auf das Klingelzeichen gewartet, stand er Sekunden später mit verschlafenem, dennoch drohendem Gesichtsausdruck im Türrahmen. Kommentarlos ging er zurück ins Bett und sah zu, wie ich mich mit dem Kind und dem Gepäck abmühte. Das schlafende Baby stellte ich samt Tragetasche auf der Couch ab.
Auf sein Rufen ging ich ins Schlafzimmer. Im Bett sitzend, mit vor der Brust verschränkten Armen, fragte er in bösem Ton, wo ich gewesen sei. Als ich wahrheitsgemäß antwortete ich wäre in Amsterdam auf Arbeitssuche gewesen, tobte er los. Er beschimpfte mich in der übelsten Weise. Ich solle ihn nicht belügen. Ich hätte herumgehurt, während ich mein Kind bei fremden Leuten abgegeben hätte. In großer Sorge um sein Kind hätte er mich nächtelang gesucht. In der winterlichen Kälte hätte er ohne Wohnmöglichkeit auf der Straße gestanden. Das wäre nun mein Dank dafür, dass er die Nächte damit verbringen würde, für uns zu arbeiten. Durch meine Schuld läge er jetzt mit hohem Fieber seit einem Tag im Bett. Zitternd vor Angst rechnete ich damit, dass er jeden Moment auf mich losgehen würde. Stattdessen spielte er jedoch den Kranken und fing plötzlich an zu jammern. Nachdem ich die Temperatur gemessen, dabei festgestellt hatte, dass er tatsächlich neununddreißig Grad hatte, versorgte ich ihm mit Wadenwickeln. Dann fuhr ich in die Apotheke um Medikamente zu holen. Fünf Tage lang pflegte ich einen jammernden, eingebildeten Kranken. Das Fieber war nach einem Tag schon wieder weg, doch offensichtlich gefiel er sich in der Rolle des bemitleidenswerten Kranken so gut, dass er seine Jammerei nicht aufgab. In dieser Zeit wusste ich manches Mal nicht, auf welches Geschrei ich zuerst reagieren sollte. Auf das des Babys oder auf seines. Ich war total im Stress.
Am fünften Tag verlangte er gegen Abend plötzlich, ich solle endlich einen Arzt holen. Auf meinen Hinweis, er habe nichts, was noch zu behandeln wäre, warf er mir vor, ich wolle ihn nur sterben lassen. Nach endlosem Hin und Her rief ich, fertig mit den Nerven, den Notarzt an. Dieser war sehr ärgerlich, dass wir ihn gerufen hatten. Er erklärte Franco, dass man nicht noch mehr tun könne, als ich schon für ihn getan hätte. Schließlich wäre er schon wieder gesund. Er solle sich nicht so verstellen, er habe nichts mehr. Dann ging er kopfschüttelnd. Auch ich hatte das Gefühl, dass Franco sich nur wichtigmachen wollte.
Gegen dreiundzwanzig Uhr passierte es dann. Während ich der Kleinen das Fläschchen zubereitete, hatte ich sie zu Franco ins Bett gelegt. Als ich das Schlafzimmer betrat, fing das Baby fürchterlich an zu schreien. Ich hatte gerade noch gesehen, dass Franco das Kind in die Wange gekniffen hatte, deshalb schrie die Kleine vor Schmerzen. Zornig schimpfte ich ihn aus, was er für ein Grobian, ein Rabenvater sei? Einem so kleinen Baby so weh zu tun. Ich war Außer mir. Er behauptete, das könne dem Baby nicht weh tun, er habe nicht fest gekniffen. Wie zur Demonstration kniff er mich in die Wange, dass ich vor Schmerz aufschrie. Aus einer spontanen Reaktion heraus schlug ich zu. Ich gab ihm eine kräftige Ohrfeige. Das war ein Fehler. Wütend sprang er aus dem Bett, dann trat und schlug er mich. Das Baby schrie, er lauter!
Was ich mir einbildete, wer ich denn sei? Er werde mir zeigen, wie weit ich gehen dürfe! Ich hätte das zu tun, was er wolle und nichts anderes. Wenn ich es noch einmal wagte, ohne seine Erlaubnis irgendwohin zu gehen, werde er mich umbringen. Brutal hatte er mich am Boden zusammengeschlagen. Dann ging er gelassen ins Badezimmer.
Читать дальше