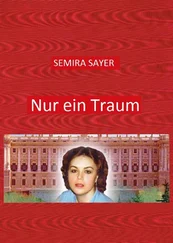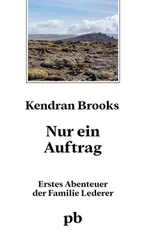Am liebsten hätte ich ihr den Mittelfinger gezeigt und gesagt: „Wie wäre es mit dem hier, Süße?“, doch auch dies wurde von der Vernunft unterbunden. Und warum eigentlich nicht? Ich hatte meine Wohnung bereits gekündigt. Ich wollte mich eigentlich bei Freunden unterbringen, bis ich meine neue Stelle antrat. Patrick, ein Kellner den ich hier in meiner Ausbildung kennen gelernt hatte, hatte mir bereits angeboten, bei ihm zu wohnen, für die zweieinhalb Monate, die mir noch blieben. Eigentlich wollte ich in dieser Zeit von meinem wenigen Ersparten (das noch maßgeblich von vor meiner Ausbildung war…) leben und ein paar Freunden hier und da unter der Hand helfen. Ich brauchte nach diesen rasanten drei Jahren etwas Urlaub, bevor ich in einen neuen Job würde beginnen können. Aber das Geld war schon verlockend. Ich würde bei Patrick nur einen kleinen Teil zur Miete dazuzahlen, hätte also die Möglichkeit, wieder etwas mehr zur Seite zu legen, für den Umzug. Oder den Passat.
„Machen Sie mir einen Vertrag fertig …“, sagte ich unvermittelt. „Ich gebe Ihnen die Tage Bescheid.“, antwortete ich und beendete das Gespräch damit im Grunde auch. Danach kamen nur noch einige Plattitüden, bis ich mich wieder im Aufzug befand, der mit hauchdünnem Onyx ausgekleidet war. Die Aufzugkabine hatte sicherlich mehr gekostet, als all meine Ausbildungsvergütung zusammen.
Die Aufzugtür öffnete sich mit einem leisen Glockenschlag. Ich war nun im Gästebereich, im Erdgeschoss, wo sich das Restaurant und die Onyx-Bar befanden. Als ich den Aufzug verließ, musste ich nur zwei Mal um die Ecke gehen, bis ich zu einer unauffälligen Tür mit einer Milchglasscheibe kam. Es spielte ruhige Jazzmusik und meine Schritte schienen auf dem dicken Teppich lautlos zu sein. Ich durchschritt diesen Flur eines der letzten Male, obwohl ich noch einen Monat hinter der Milchglastür verbringen würde. Irgendwie wusste ich, dass es ein Abschied war und nahm den arteigenen Geruch, den jedes Haus und jeder Ort, den man in und auswendig kennt, doch irgendwie hat, in mir auf. Ich drückte die goldene Türklinke und der Jazz verstummte. Er wurde von geschäftigem Lärm abgelöst. Die Nussbaumvertäfelungen, die zuvor bis auf Hüfthöhe die Flure geschmückt hatten, waren verschwunden, ebenso wie das gedimmte Licht. Es war erstaunlich, wie eine einzelne Tür zwei Welten voneinander trennen konnte. Auf der anderen Seite, auf der ich den allermeisten Teil meiner Ausbildung verbracht hatte, sah es nicht mehr so aus, wie man sich zunächst ein fünf-Sterne-Superior-Hotel vorstellte. Ein grelles Neonröhrenlicht erleuchtete jeden Winkel. Die Wände des gesamten Backoffice-Bereichs waren zur Hälfte dunkelgrau gestrichen, wobei man auch nicht mehr von einem flächendeckenden Grau sprechen konnte. Eigentlich war der untere Teil der Wand übersäht mit Katschen und Kratzern. Ich für meinen Teil kann mich nicht davon freisprechen, das eine oder andere Mal mit einem Leiterwagen an der Wand vorbeigeratscht zu sein. Ein schlechtes Gewissen hatte ich deshalb nie. Es war ja keine Absicht; außerdem lässt die Konzentration nach 14 Stunden eben einfach manchmal nach.
„Moin Julius …“, tönte es, während jemand – ich konnte nicht genau erkennen, wer es war – sehr zügigen Schrittes den Serviceflur entlanglief. Er zog eine Windböe hinter sich her und einige Function-Sheets und Bankett-Laufzettel flatterten an der gegenüberliegenden Pinnwand. „Moin!“, kam es reflexartig von mir zurück. Ich drehte mich um und sah zwischen all diesen Papieren einen Zettel mit der Überschrift „Zugänge und Abschiede“. Es waren einige fürchterlich ernste Bilder dabei. Sehr geschäftsmännisch und selbstsicher in einem Kellerfotostudio gemacht und schließlich mit einem Groupon-Gutschein bezahlt. Damals überkam mich eine leichte Übelkeit, als ich daran dachte, wie zuwider mir diese ganze Scheinheiligkeit doch war. Jobs und Berufe waren doch für Menschen gemacht – und nicht etwa andersherum. Gleichzeitig stimmte es mich sehr traurig, dass die meisten Menschen glauben, jemand anderes sein zu müssen, damit sie einen Job bekommen. Anstatt einen Job bekommen zu wollen, weil man so ist, wie man ist. Nach dem dritten Kai-Pflaume-Lächeln war ein Foto, das aus der Reihe stach. Es war ganz anders als die anderen und stach besonders durch die mittelmäßige Qualität und das unvorteilhafte Kermit-der–Frosch-Grinsen, hervor. Es prangte als erstes unter der Überschrift „Abschiede“. Da war ich nun, nicht zottelig, aber auch nicht gestriegelt. Ich saß einfach da, mit einem weinrot und beige karierten Hemd und blickte in die Kamera, als hätte ich kein Wässerchen trüben können. Und vielleicht war es ja auch damals so. Ich lächelte wieder, als ich mich vor der Pinnwand wiederfand. Doch das Lächeln verflog wie eine leichte Brise einer längst vergangenen Zeit.
Ich bog am Ende des Ganges rechts ab und befand mich vor einer doppelflügeligen Holzschiebetür mit Bewegungssensor. Ich hatte in den letzten drei Jahren gelernt, nicht im Weg zu stehen und wusste genau, wo ich sein musste, damit die Kellner und Restaurantfachleute ihrer Arbeit nachkommen konnten. Ich harrte noch einige Minuten vor der Küchentür aus, bevor ich schließlich den letzten Schritt tat und der Bewegungsmelder seinen Dienst vollrichtete. Der Lärm wurde lauter. Pfannen und Sautoires klapperten auf dem alten Schamottstein-Herd beim Entremetier und Steaks und Entrecôtes zischten auf dem Holzkohlegrill beim Saucier . Ich bahnte mir meinen Weg durch die Küche, die drei Jahre lang mein Zuhause gewesen war. Ich kannte jede Ecke, jeder Winkel war mir beim Putzen, das ich so oft hinter mich gebracht hatte, im Gedächtnis geblieben. Ich ging in das Büro des Küchenchefs, um mich zu verabschieden. Nie ist mir ein Abschied so leicht und auf eine nostalgische, melancholische Weise doch so schwer gefallen…
***
Ich hatte tatsächlich einen Parkplatz für den Passat gefunden, nachdem ich meine Messertasche, meine Kochjacken und das restliche wenige Equipment, das ich besaß, in meiner Wohnung ausgeladen hatte. Es war Abend geworden und einige Wolken verdeckten den zuvor recht blau gewesenen Himmel. Während des Einparkens hatte ich bereits gemerkt, dass einige Regentropfen auf der Windschutzscheibe gelandet waren. Der Supermarkt war nicht allzu weit von meinem Parkplatz entfernt. Um genau zu sein, ich parkte ziemlich in der Mitte der Strecke von meiner Wohnung zu diesem. Ich fasste kurzerhand den Entschluss, meine leichte dunkelblaue Harrington-Jacke überzuziehen und das mir selbst versprochene Sechserpack Tannenzäpfle zu kaufen. Das Türschloss machte sein typisches Klacken, als ich den Hebel betätigte, um die Türe zu öffnen. Die Luft war noch recht warm gewesen, jedoch merkte man, dass ein böses Gewitter aufzog. Vielleicht bildete ich es mir auch ein, doch hatte ich das Gefühl, dass ich einzelne Tropfen abbekommen hatte, als ich den abgenutzten VW Schlüssel in das Türschloss steckte und solange darin rumstocherte, bis die Türe letzten Endes verriegelt war. Als ich gespannt Richtung Himmel blickte, war der blaue Himmel von dunklen Gewitterwolken verdrängt worden.
„Aiaiai …“, murmelte ich zu mir selbst. Selbstgespräche waren bei mir schon längst keine Seltenheit mehr. Auch wenn es meist nur Floskeln waren, war es dennoch eine Angewohnheit, die sicherlich daher kam, dass man alleine im Kühlhaus etwas suchte, das Trockenlager aufräumen musste oder seinen Gedanken im alltäglichen Überlebenskampf mit einer unterbesetzten Küche, Freiraum schaffen muss.
Meine Arbeitsschuhe waren recht unbequem gewesen und ich fühlte mich in meinen Turnschuhen, die ich mir erst vor einem Monat von etwas Ersparten gegönnt hatte, erheblich wohler. Dennoch nervte es mich, dass sie auf vielen Fußböden – so wie dem im Supermarkt – quietschten. Als ich durch die Reihen des Supermarktes schlenderte (quietsch, quietsch, quietsch!) und den stärker werdenden Regen auf den geschlossenen Oberlichtern gespenstisch trommeln hörte, überkam mich ein kleines Schaudern. Ich liebte es, wenn es regnete – zumindest, wenn die Aussicht bestand, dass ich mich in meiner kleinen Wohnung, wo es weitestgehend trocken war, verkriechen und Lesen oder Musik hören konnte.
Читать дальше