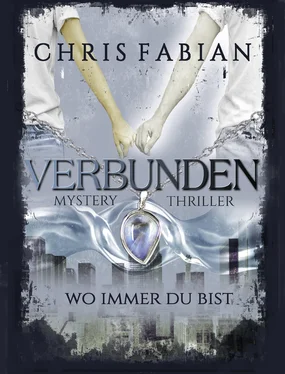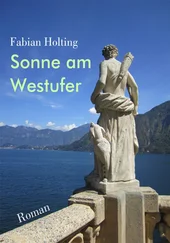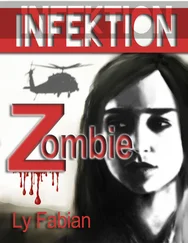„Sie fürchten sich“, murmelte sie in Stephensons Richtung. „Sie haben Angst, nie wieder aus diesem Zimmer entrinnen zu können. Ms. Stephenson, bitte glauben Sie mir: Sie können es schaffen. Lassen Sie die Vergangenheit hinter sich! Gehen Sie zur Tür, drehen Sie sich nicht um. Drücken Sie die Klinke hinunter. Verlassen Sie das Zimmer. Ich bin bei Ihnen. Niemand wird Sie daran hindern.“
Wieder weinte die Patientin. Luna beobachtete die körperlichen Reaktionen genau, sah, wie Stephenson den Kopf zwischen die Schultern zog, und hörte, wie sie den Atem erregt über die Lippen stieß. Das bewies, wie konzentriert sie mitarbeitete.
Sie wartete ab, doch Stephenson brauchte noch einen Moment, und Lunas Blick schweifte wieder zu der breiten Fensterfront im Erdgeschoss des Psychatric-Centers, vor der ein Busch-Natternkopf die ersten Knospen öffnete. Regentropfen benetzten ihn nun, doch die Sonne schien unbeirrt weiter. Irgendwo musste ein Regenbogen zu sehen sein.
„Ich traue mich nicht zur Tür. So schrecklich dunkel“, murmelte die Patientin. „Nur das Nachtlicht in der Steckdose schimmert. Mein Herz klopft. Die Mama soll kommen. Sie soll es Papa sagen. Lass das Kind in Ruhe. Aber nichts passiert …“
Eine Welle des Mitgefühls und auch der Scham überrollte Luna, weil ihr das Einfühlen heute so schwerfiel.
„Es ist völlig in Ordnung, die Angst zu spüren“. Sie kritzelte mit dem Kugelschreiber die Worte Panik, Attacke, Schweißausbruch und Missbrauch auf ihren Notizblock. Dann ließ sie die Halskette mit dem Mondstein-Anhänger durch ihre Finger gleiten, wie sie es immer tat, wenn sie um Konzentration rang – ein Stein, wie ihn auch ihr Bruder Max besaß. Sitzungen mit Stephenson waren stets fruchtbar – was man nicht von allen Patienten behaupten konnte. Viele suhlten sich in ihrem Leid und blieben zeitlebens darin stecken.
„Gehen Sie ruhig in die Angst hinein. Und überlegen Sie genau“, sagte sie. „Wer könnte das kleine Mädchen in Ihnen am besten beschützen?“
„Warten Sie … Sie meinen mich, nicht wahr? Ich könnte das wohl am besten.“
Luna räusperte sich und warf einen verstohlenen Blick auf die Schreibtischuhr: Gleich waren die fünfzig Minuten voll und die Zeit war zu knapp für eine Fantasiereise oder ein Rollenspiel. Es tat ihr leid für Ms. Stephenson. Sie beschloss, um den Faden nicht abreißen zu lassen, ihr gleich eine schriftliche Übung für zu Hause auszuhändigen. Die Übung hatte zum Ziel, das Selbstwertgefühl zu stärken, ein paar Fragen wie: Was mag ich an mir? Was zeichnet meine Persönlichkeit aus? Wofür ernte ich Lob von anderen?
„Das haben Sie richtig erkannt. Sie sind erwachsen“, sagte Luna, mit fester Stimme. „Ihr Vater kann Ihnen nichts mehr tun. Nehmen Sie sich dieses Bild ruhig öfter vor. Stehen Sie auf. Gehen Sie aus der Tür …“
Ruckartig setzte Stephenson sich auf, ließ die Beine von der Liege baumeln und wandte ihr Gesicht Luna zu. „Es ist etwas passiert, Ms. Yowett.“
Das klang allerdings neu. Wieso kam das jetzt, am Ende der Stunde? Stimmen wurden laut, draußen auf dem Flur. Kein Zweifel: Das war David, der mit der Empfangsdame und gleichzeitig Lunas bester Freundin Cindy Bold debattierte. Himmel, was war denn da los?
„Allein der Gedanke bringt mich fast um.“ Mit zitternden Lippen starrte Stephenson Luna an. „Ich wollte es gar nicht erwähnen … Gestern Nacht, müssen Sie wissen, da habe ich mir ein Herz gefasst.“
Luna horchte auf, und Stephenson fuhr fort. „Ich also die verdammte Tür geöffnet, so, wie Sie es mir immer raten. Und da stand sie. Meine Mutter.“
Etwas schlug gegen die Fensterscheibe, gleichzeitig klopfte jemand. Luna blieb fast das Herz stehen. „Einen Moment bitte“, rief sie barsch Richtung Tür. Dann sah sie Stephenson an. Hatte sie richtig gehört? Stephenson hatte „gestern Abend“ gesagt?
„Aber – Ihre Mutter liegt im Sterben“, murmelte sie. Die Ärzte hatten der Krebskranken noch einen Tag gegeben, vielleicht zwei.
„Es war ihr Geist. Verstehen Sie? Sie nahm mich an der Hand, brachte mich ins Bett zurück und sagte, dass es ihr leidtäte. Dass jetzt alles gut würde. Dass sie mich ab jetzt beschützen würde. Aber, im Ernst? Das macht mir genauso viel Angst. Der Geist meiner Mutter!“ Mit irrem Ausdruck winkte sie Luna zu sich heran. „Sagen Sie mir die Wahrheit, Ms. Yowett: Bin ich verrückt geworden?“
In der Tür stand David, doch als Luna in sein ernstes Gesicht sah, verbiss sie sich die scharfen Worte.
„Bin sofort bei dir.“ Sie sah ihn an. Er zögerte, nickte dann knapp und die Tür fiel mit leisem Klicken ins Schloss.
Sie merkte selbst, wie monoton ihre Stimme klang. Ja, Sie sind verrückt, hätte sie am liebsten zu Stephenson gesagt, doch sie schwieg.
„Tut mir leid, aber für heute ist Schluss. Holen Sie sich bitte zeitnah einen Termin. Die Entwicklung mit Ihrer Mutter sollten wir dringend beleuchten.“
Wider Erwarten wirkte Stephenson sehr gefasst, als sie mit dem Kinn zum Glastisch wies. „Ist gut. Sind das da meine Hausaufgaben?“
Luna schenkte ihr ein Lächeln. Stephensons Verständnis nährte ihr schlechtes Gewissen. Sie hätte wenigstens kurz auf ihre letzte Befürchtung eingehen sollen: ihre Angst, den Verstand zu verlieren.
„Lassen Sie sich Zeit mit den Fragen“, antwortete sie sanft. Und als Stephenson nach den Unterlagen griff und zur Tür ging, legte Luna den Notizblock beiseite, stand auf und folgte ihr. „Alles wird gut, Sie werden sehen“, murmelte sie, auch wenn sie ihrer Worte nie unsicherer war als in diesem Moment.
Mit einem Gruß verließ die Patientin den Raum, während Luna zum Fenster trat, um, wie immer, zwischen den Stunden zu lüften – auch, um Zeit zu gewinnen. Den Schrecken, der sie in Davids Gesicht erwartete, hinauszuzögern. Etwas stimmte hier nicht!
Ihr Blick wanderte hinab auf die Brüstung des französischen Balkons. Zwischen Geländer und Fensterscheibe hing ein Rabe, das Köpfchen kraftlos, einen Flügel zur Seite geklappt. Oberhalb seiner gebrochenen Augen, die Luna anstarrten, prangte eine winzige weiße Feder. Himmel! Das arme Ding hatte sich beim Flug gegen die Scheibe das Genick gebrochen. Das war schlimm genug und das Tier tat Luna leid. Doch es ähnelte stark dem Raben aus ihrem Traum letzte Nacht!
Ihr Herz klopfte hart gegen ihre Brust. Sie zwang sich, langsam ein- und auszuatmen, um ihren Puls herunterzufahren. Auch wenn David es als Chefredakteur des San Diego Union Tribune schon allein von Berufs wegen gewohnt war, sich in Dinge einzumischen: Es war so ganz und gar nicht seine Art, Lunas Sprechstunde zu stören. Und jetzt dieser Rabe … ein schlechtes Omen?
Sie hörte, wie Cindy der Patientin draußen im Flur in den Mantel half. Gleich darauf lugte Cindy, in blauem Rock und weißer Bluse, zur Tür herein.
„Alles klar, Boss?“
„Ich bin nicht sicher.“ Sie drehte sich um. „Du, Cindy?“
„Hm?“
„Hier am Fenster. Genickbruch. Informierst du bitte den Caretaker?“
Cindy machte große Augen und nickte mit offenem Mund und während sie langsam zum Fenster ging, verließ Luna den Raum.
Im Wartezimmer tigerte David rastlos umher. Den Kaffee, den Cindy ihm hingestellt hatte, ignorierte er. Das war kein gutes Zeichen.
Luna nahm allen Mut zusammen.
„Also? Was ist so dringend?“
Er blieb abrupt stehen, seine Arme hingen schlaff hinunter.
„Es geht um deine Eltern.“
Es klopfte. „Entschuldige, dass ich störe. Bin auch gleich wieder weg“. In der Türfüllung tauchte Cindy auf. „Der Hausmeister weiß Bescheid, ich meine, wegen des Raben. Und soll ich die restlichen Termine verlegen?“ Neugierig schaute sie von David zu Luna. Nur Cindys angenehm ausgeglichener Art war es zu verdanken, dass Luna die Ruhe bewahrte.
Читать дальше