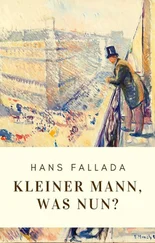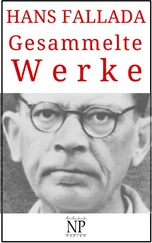Hans Fallada - Kleiner Mann, großer Mann, alles vertauscht
Здесь есть возможность читать онлайн «Hans Fallada - Kleiner Mann, großer Mann, alles vertauscht» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Kleiner Mann, großer Mann, alles vertauscht
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Kleiner Mann, großer Mann, alles vertauscht: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Kleiner Mann, großer Mann, alles vertauscht»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Kleiner Mann, großer Mann, alles vertauscht — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Kleiner Mann, großer Mann, alles vertauscht», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Und er beantragte zum zwölften Mal mit trocken knarrender Stimme völligen Erlaß eines Viertels der Erbschaftssteuer; Anzahlung von hundertfünfzigtausend Mark und Abtrag des Steuerrestes in fünfzig Jahresraten.
Die Herren vom Steueramt lächelten dünn. Schließlich sei Gaugarten nichts Unteilbares, ein oder zwei seiner Vorwerke seien zweifellos leicht verkäuflich. Auch dann bliebe für den jungen Herrn noch eine ganz hübsche Erbschaft.
Dies rief meinen Administrator Kalübbe auf den Plan. Er bewies haargenau, daß der Verkauf der Vorwerke den völligen Ruin der Begüterung bedeuten würde. Er redete von Verteilung der leichteren und schwereren Böden, er redete von Hackfruchtbau und der Kartoffelbelieferung meiner Stärkefabrik Kleinschönchen. Er legte Düngungs- und Erntetabellen vor, er berechnete den Lohnbedarf in den ertraglosen Wochen vor der Ernte ...
Schließlich kam er zu dem Ergebnis, daß einerseits eine Abschlagszahlung von vierhunderttausend Mark wohl zu verantworten, andererseits ein sicherer Zins- und Tilgungsdienst für eine Hypothek von einer Million nicht zu garantieren sei. – Denn ein Landgut ist keine Fabrik, meine Herren! Mit Bestellung und Saat tun wir unser Bestes, aber unsere Ernte steht allein in Gottes Hand, das vergessen Sie bitte nicht, meine Herren!
Er sah uns ergeben an, der Herr Kalübbe, und sagte dann plötzlich griesgrämig: Und das Wetter wird auch alle Jahre saumäßiger!
Ich saß dabei und hörte mir diese ewigen Redereien an; nie schienen sich die drei Ansichten auch nur ein wenig zu nähern! Wenn ich offen sein soll, so dachte ich bei mir: die Herren vom Steueramt haben ganz recht, es bleibt immer noch genug.
Eigentlich war ich also der Ansicht der Herren vom Steueramt, aber das durfte ich nicht sagen, oder ich wagte es nicht zu sagen. Denn in den Einwänden der Herren Steppe und Kalübbe schien mir auch etwas Wahres zu sein. Was wir ohne alle Reserven bei einer Missernte anfangen sollten, wußte ich auch nicht. Und ob die Stärkefabrik in Kleinschönchen ohne die Kartoffeln von Trassenheide zum Ruin verurteilt war, konnte ich beim besten Willen nicht beurteilen.
So saß ich also ziemlich stumm dabei und wurde immer unlustiger und verdrossener. Gelangweilt verfolgte ich das Blitzen des Lichtes in der Brille von Herrn Steppe und die Bewegungen eines großen Siegelringes, den Herr Kalübbe an seinem Finger trug.
Herr Steppe war ein Feind von Herrn Kalübbe, das war nicht schwer zu merken. Eigentlich war Herr Kalübbe nach Herrn Steppes Mitteilungen gar kein so besonderer Landwirt: Betrachtet man seine Leistungen, so ist sein Gehalt viel zu hoch, hatte mir der Justizrat schon kurz nach Erbantritt, und noch viele Male danach, versichert. Aber er hat Ihren Onkel immer irgendwie rumgekriegt – eigentlich rätselhaft!
Ich verschwieg Herrn Steppe, daß Herr Kalübbe auch mich schon bei unserem ersten Kennenlernen rumgekriegt hatte, ihm nämlich eine Gehaltserhöhung zu bewilligen. Ich verschwieg Herrn Steppe weiter, daß mich Herr Kalübbe – in einem unbewachten Augenblick – über die tieferen Gründe des steppischen Widerstandes gegen die Vorschläge des Steueramtes aufgeklärt hatte.
Wozu sollen wir denn fast eine halbe Million Betriebskapital gebrauchen, Herr Schreyvogel? So was ist ja lächerlich! Nee, der gute olle Justizrat will das Geld bloß nicht ausspucken, weil er Ihr bares Vermögen für Sie verwaltet und natürlich feste daran verdient. Gaugarten ist ihm ganz egal, ob das größer oder kleiner ist, daran verdient er nichts. Immer helle, Herr Schreyvogel! Passen Sie auf, am Ende willigt er ein, Trassenheide zu verkaufen – da beißt er bei uns aber auf Granit, nicht wahr, Herr Schreyvogel?
Auf der anderen Seite verschwieg ich wieder Herrn Kalübbe, daß mir Herr Justizrat Steppe geraten hatte, den Administrator vorläufig noch beizubehalten, da er in alles eingearbeitet sei ...
Aber wenn Sie erst richtig fest im Sattel sitzen, mein lieber Herr Schreyvogel, dann machen wir mal eine große, gründliche Buch- und Inventarprüfung. Da soll der Herr mal sehen, wo er bleibt! – Ich muß gestehen, setzte er abmildernd hinzu, das ist nicht einmal eine Idee von mir. Ihr Onkel Eduard hat dem Herrn schon immer mißtraut! Welch vernünftiger Mensch trägt auch solch einen Siegelring bei dem Namen Kalübbe, als wäre er vom Uradel! – Aber bitte, vorläufig nichts merken lassen, mein verehrter Herr Schreyvogel! Vorläufig brauchen wir den Mann noch, in seiner Art ist er ja ganz brauchbar ...
Zwischen all diesem Geklatsch und Einander-Schlechtmachen saß ich, und alle behaupteten, in meinem Namen zu reden und für meinen Nutzen und Vorteil zu handeln. Aber das von Onkel Eduard gesäte Mißtrauen wucherte immer stärker in mir, und so recht glaubte ich keinem Menschen mehr. Ich traute ihnen allen nicht und sagte mir doch immer wieder: es ist ja gar nicht möglich! Es sind doch alles ehrenwerte Männer, alle älter als ich, erfahrener als ich. Über keinen ist etwas Schlechtes bekannt – warum sollen sie gerade bei dir ihre Pflicht nicht tun und schlecht werden?! Nein, es ist nicht möglich!
Es wucherte aber doch weiter, und ich schämte mich dieses Wucherns, darum wagte ich Karla auch kein Wort davon zu sagen.
Wenn wir dann nach solcher ergebnislosen Verhandlung wieder nach Hause fuhren und Herr Kalübbe sagte: Kommen Sie doch mal wenigstens morgen für einen Tag mit Ihrer Frau Gemahlin zu uns raus und sehen sich Ihre Klitsche wenigstens einmal an!
Dann dachte ich: Natürlich, er will dich für sich allein haben und dich zu irgend etwas überreden, zu einer Gehaltserhöhung oder sonst etwas Eigennützigem!
Und wenn dann der Justizrat antwortete: Das ist recht. Natürlich. Aber morgen und übermorgen wird es schlecht gehen, es liegt sehr viel Post unerledigt da, nicht wahr, Herr Matz?
– So dachte ich wiederum, daß der Justizrat mich nur nicht fortlassen wollte aus dem Hotel, wo ich so gut unter seiner Bewachung stand.
Und wenn dann Herr Matz antwortete: Gewiß, Herr Justizrat, etwas viel Post liegt da. Aber vielleicht läßt es sich gegen Ende der Woche einrichten, wenn Herr Schreyvogel den Wunsch hat –?
– So grübelte ich: Zu wem hält nun Matz? Zum Justizrat? Oder zu Kalübbe? Oder vielleicht gar zu mir –?
Und kam aus dem Argwohn und Mißtrauen überhaupt nicht mehr heraus.
14. Kapitel
Einsamkeit der Reichen – Die mißlungene Abendgesellschaft – Gemeinsames Weinen – Das Hagel-Mikroskop
Wenn Karla und ich zu Abend gegessen hatten, sahen wir noch einmal zu unserer kleinen Mücke hinüber. Sie lag dann schon in ihrem Bett, und wir sagten ihr gute Nacht, argwöhnisch bewacht von Fräulein Kiesow, die sehr darauf hielt, daß die Kleine nicht ›aufgeregt‹ wurde.
Dann gingen wir zurück in unser trostloses Hotelzimmer aus Eiche und Samt, starrten einander an, blätterten in Zeitschriften und warteten gähnend darauf, daß es halb zehn wurde, eine Zeit, zu der wir unserer Ansicht nach mit Anstand ins Bett gehen konnten.
In den ersten Palast-Hotel-Tagen war alles natürlich überwältigend neu gewesen, aber kaum hatten wir uns eingewöhnt, so vermißten Karla und ich schon unsere Freundschaft. Es kam uns so seltsam vor, daß sie sich gar nicht um uns kümmern sollten, um uns, die doch solchen Glücksfall erlebt hatten.
Wir gingen der Sache nach und erfuhren, daß unsere Freunde genau wie alle beliebigen Bittsteller abgewiesen worden waren: Herr und Frau Schreyvogel sind zu beschäftigt. Sie können vorläufig niemanden empfangen.
Wir lehnten uns auf, Herr Matz, Herr Hutap, der Hotelportier, alle bekamen ihr Teil zu hören. Und dann luden wir unsere ganze Freundschaft ein, zu einem pompösen Abendessen im Palasthotel, in unseren ›Privatsalon‹.
Ich sehe dich noch, Karla, wie du mit geröteten Wangen eifrigst umherliefst, wie du nach Konfekt schicktest, wie du kunstvoll eine Obstpyramide für den Nachtisch aufbautest, wie du Knallbonbons besorgen ließest und Luftschlangen. Es sollte ein sehr vergnügter Abend werden, die Freunde sollten es wirklich einmal sehr gut haben ...
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Kleiner Mann, großer Mann, alles vertauscht»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Kleiner Mann, großer Mann, alles vertauscht» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Kleiner Mann, großer Mann, alles vertauscht» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.