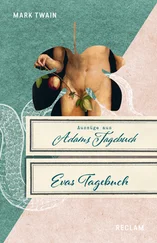Ich warf mich von einer Seite auf die andere, doch mein sogenanntes Nachtlager wurde dadurch auch nicht bequemer. Der Boden war schlichtweg zu hart. Mir fehlte ein Kissen für den Kopf. Außerdem war mir nach wie vor übel, in meinem Schädel pochte es unentwegt und meine feuchten Kleider klebten auf meiner Haut. Mittlerweile war unter ihnen eine unangenehme Wärme entstanden, die mich an die Schwüle erinnerte, die vor einem Gewitter im Hochsommer herrscht. Man wusste bei solchen Witterungsbedingungen nie, was man tun sollte: frieren oder schwitzen? Genauso ging es mir jetzt. Doch dies war noch nicht alles, was mich vom Schlafen abhielt. Hinzu kam das immer wiederkehrende Gemurmel meines Vaters, das von der anderen Seite des Raumes zu mir herüberdrang. Er faselte etwas von: „Der Boden ist geheiligt. Vor der Nacht bin ich sicher.“ Ich hatte keine Ahnung, was diese Worte zu bedeuten hatten, aber es war recht interessant, dass er davon sprach, dass er sicher war und nicht wir . Hatte er diese Sätze gesprochen, kehrte für eine Weile Ruhe ein. Ich atmete erleichtert aus und wagte mich an einen neuen Versuch, Schlaf zu finden. Doch dann ertönte meines Vaters Stimme abermals und ließ mich zusammenfahren. Dieses Schauspiel hielt nun schon die halbe Nacht an. Als er anfing, zum tausendsten Male dieselben Worte zu murmeln, setzte ich mich auf und lugte hinter der Stiege hervor, um nach ihm zu sehen. Er saß noch immer vor dem Regal, wo er sich niedergelassen hatte, umklammerte die Amphore mit dem Cidre darin und starrte zu mir herüber. Der Schein der Kerze neben ihm zeichnete dunkle Schatten auf sein Gesicht und verlieh seinen Augen einen unwirklichen Schimmer und Ausdruck, sodass sie wirkten, als wären sie nicht von dieser Welt. Während er mich beobachtete, wiegte er seinen Oberkörper vor und zurück. „Der Boden ist geheiligt. Vor der Nacht bin ich sicher“, sagte er.
„Wieso fürchtest du die Nacht?“, wollte ich von ihm wissen. Mein Vater hörte prompt damit auf, vor und zurück zu schaukeln, und gab einen langgezogenen Seufzer von sich. Dann schüttelte er den Kopf, und als er seinen Blick wieder auf mich richtete, war der entrückte Ausdruck in seinen Augen verschwunden. „Wieso fürchtest du die Nacht?“, wiederholte ich meine Frage für den Fall, dass er sie in der Welt, in der er zuvor gewesen war, nicht gehört hatte. „Du hast so oft unter freiem Himmel geschlafen, wenn du weggefahren bist. Ich dachte, du wüsstest, wie es ist, nachts draußen zu sein.“
Mein Vater schnaubte. „Ich habe nie in der Wildnis geschlafen. Ich habe mir stets ein Dach gesucht, unter dem ich sicher war. Nur wer den Tod freiwillig sucht, bleibt in der Dunkelheit draußen“, antwortete er.
„Wieso das?“, fragte ich. Neugierig geworden, kam ich weiter hinter der Treppe hervor und hoffte auf Erklärungen. Doch ich wurde enttäuscht. Mein Vater schien zu denken, er habe bereits zu viel preisgegeben und hielt den Mund. „Was ist da draußen?“, versuchte ich es erneut, ihn zum Sprechen zu bewegen, aber er war schon wieder in das Schaukeln verfallen und in seine eigene Welt eingetaucht. „Papa?“
„Still jetzt! Ich will nichts mehr hören“, sagte er streng, setzte die Amphore an die Lippe und nahm einen ordentlichen Schluck. Als er genug getrunken hatte, stellte er das Gefäß beiseite, wischte sich den Mund ab und lehnte den Kopf zurück gegen das Regal. „Vor der Nacht bin ich sicher, bin ich sicher. Vor der Nacht bin ich sicher, sicher, sicher“, flüsterte er.
Es war wie eine Art Singsang, mit dem er sich selbst Mut zuzusprechen schien. Aber wozu brauchte er Mut, wenn er doch auf geheiligtem Boden sicher war, wie er so oft gesagt hatte? In dem Moment, in dem ich diesen Gedanken hatte, sah mich mein Vater an, und plötzlich begegneten mir in seinen Augen Zweifel und Angst. Das, woran er glaubte, war ins Wanken geraten allein durch die Tatsache, dass ich vor ihm saß. Ich war es, den er als die Nacht ansah. Doch diese Nacht war nun hier, auf dem geheiligten Boden der abgebrannten Kirche, obwohl es nicht möglich sein sollte. Zumindest glaubte mein Vater daran. Großartig! Nicht nur, dass ich seiner Meinung nach einen Dämon in mir hatte. Nein. Jetzt war ich auch noch die lebendige, atmende Nacht höchstpersönlich.
Seufzend kroch ich zurück hinter die Stiege und legte mich hin. Ich war es so leid, dem Irrsinn meines Vaters ausgesetzt zu sein und als Monster oder Kreatur des Bösen angesehen zu werden. Von mir aus , dachte ich und spürte, wie mich eine gewisse Gleichgültigkeit überkam, die auch Ruhe mit sich brachte. Ich konnte meinen Vater nicht vom Gegenteil überzeugen, dass ich nicht die Nacht war, und dass ich es geschafft hatte, den heiligen Boden zu betreten, half auch nicht dabei, ihn umzustimmen. Was auch immer er von dieser Wendung hielt, ich glaubte, letzten Endes fürchtete er sich mehr vor mir als ich mich vor ihm. Und was ich außerdem verstand, war, dass er mir schon früher etwas hätte antun können, wenn er es gewollt hätte. Ich war lange Zeit ohnmächtig gewesen. Doch anstatt mich zu erschlagen, den Wagen einen Abhang hinunterstürzen zu lassen oder mich irgendwo auszusetzen, hatte er mich in Ruhe gelassen und hierher gebracht, wo wir , nicht nur er , sicher waren, auch wenn sein Weltbild gerade dabei war einzustürzen.
Ich danke dir, Gott, dass Du mir geholfen hast, dies zu erkennen , dachte ich. Eine wohlige Wärme durchflutete mich, die wie eine Antwort auf meine Danksagung war. Ja, Gott war bei mir. Er hatte mich bis hierher beschützt. Er würde mich weiterhin beschützen. Ich hatte einen himmlischen Helfer, den Helfer schlechthin. Ich lächelte in der Dunkelheit und schloss die Augen. Und wenig später schlief ich ein.
„Steh auf! Es ist Zeit aufzubrechen.“ Auf die wenig freundlichen Worte folgte die unsanfte Berührung einer Schuhspitze, die mir ins Bein stieß.
Stöhnend setzte ich mich auf und rieb mir über die noch müden Augen. „Wie spät ist es?“, fragte ich meinen Vater.
„Spät genug. Hoch mit dir!“, befahl er und stieß mich erneut mit dem Fuß an. Über Nacht schien er eine neue Art von Schikane gefunden zu haben, die ihm offenbar viel Vergnügen bereitete. Bevor er mir noch weitere blaue Flecken verpassen konnte, kam ich unter dem Getreidesack hervor und stand auf. Mein Vater entfernte sich von mir und lief hinüber zu den mit Essensvorräten gefüllten Regalen. Ich beobachtete ihn dabei, wie er sich ein Frühstück genehmigte in Form von Käse, Pökelfleisch und Quitten. Gierig schlang er alles hinunter, als gäbe es kein Morgen, und suchte sich zusätzlichen Proviant für unsere Weiterfahrt. Mein Magen knurrte, und ich verspürte einen Appetit auf die Köstlichkeiten, in dem ich ein Zeichen für meine Genesung sah. Ich hatte nach wie vor Kopfschmerzen, aber mir war nicht mehr schlecht. Ich fror auch nicht mehr. Selbst meine Kleider waren getrocknet. Alles in allem fühlte ich mich besser. In der Nacht hatte ich davon geträumt, krank geworden zu sein. Ich hatte mich auf dem Wagen meines Vaters liegen gesehen, hustend, niesend und im Fieberwahn. Selbst jetzt noch hörte ich meinen röchelnden Atem und überlegte, ob es wirklich nur ein Traum gewesen war oder ich tatsächlich gehustet hatte. Es hatte sich so echt angefühlt! Wenn dem so gewesen sein sollte, hatte Gott sein Versprechen gehalten, mich beschützt und geheilt. Ich fühlte mich bei Weitem besser als tags zuvor. Mit neuer Kraft machte auch ich mich daran, etwas zu essen. Als ich einen Bissen vom Käse nahm, glaubte ich erneut zu träumen, so gut schmeckte er. Ich hatte nie etwas Besseres gegessen.
„Wir müssen los!“, hörte ich meinen Vater hinter mir sagen. Immer noch kauend wandte ich mich um und fand ihn auf der Stiege stehend vor. Mit seinen Händen drückte er die Metalltür über sich auf. Quietschend öffnete sie sich, und ein erster heller Sonnenstrahl fiel in den Raum. Mein Vater kletterte weiter die Treppe hinauf und drückte gleichzeitig die Luke nach oben, bis sie schließlich krachend auf den mit Asche bedeckten Boden der Kirche fiel. Bei dem Geräusch zuckte ich zusammen, zog Kopf und Schultern ein und stöhnte, weil mir der Lärm in den Ohren wehtat. „Wir haben noch ein weites Stück des Weges vor uns. Komm jetzt!“, forderte er mich auf und sah, auf der obersten Stufe stehend, zu mir herüber. Das grelle Sonnenlicht strahlte ihn von hinten an, sodass ich nur seine dunkle Silhouette erkennen konnte. So ist das also? Es gab genügend Zeit, damit er sich satt essen und sogar Verpflegung für unterwegs einpacken konnte, aber für mich gab es nicht einmal so viel Zeit, wie es für einen Hahn braucht zu krähen? Innerlich ärgerte ich mich über sein Verhalten und wäre am liebsten trotzig dort geblieben, wo ich war. Aber ich wusste auch, dass es sinnlos gewesen wäre. Er hätte ohnehin seinen Willen durchgesetzt. Auf die eine oder andere Weise. Somit brach ich mir ein weiteres Stück Käse aus dem Laib heraus, angelte mir zwei Äpfel und eine Karotte und stopfte alles in meine Hosentaschen. Dann lief ich zu meinem Vater hinüber und folgte ihm nach draußen.
Читать дальше