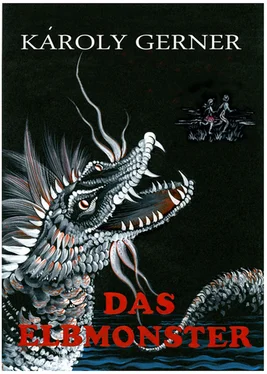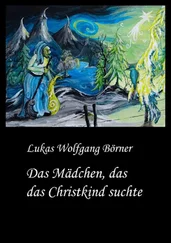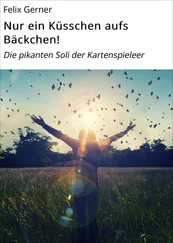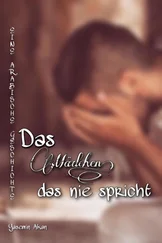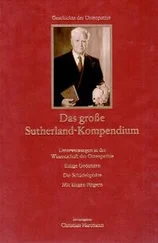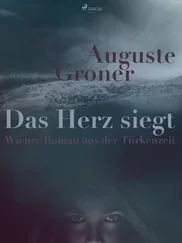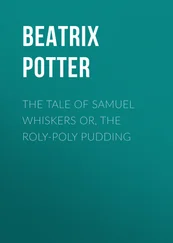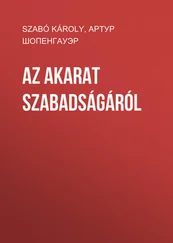Gerner, Károly - Das Elbmonster
Здесь есть возможность читать онлайн «Gerner, Károly - Das Elbmonster» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Das Elbmonster
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Das Elbmonster: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Das Elbmonster»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Das Elbmonster — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Das Elbmonster», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Wenn ich gelegentlich meinen Kindern und Enkeln davon erzähle, fühlen sie sich regelrecht in eine Märchenwelt hinein versetzt oder glauben gar, ich hätte dereinst noch unter urgesellschaftlichen Verhältnissen gelebt.
Sicher, wir hatten damals weder elektrischen Strom (bei Dunkelheit zauberte eine Petroleumlampe etwas Licht in die karge Behausung), ergo auch kein Radio, geschweige denn Fernsehen oder sonstige moderne Informationsmittel, noch Anschluss an ein öffentliches Wassernetz beziehungsweise überhaupt kaum Teilhabe an zivilisatorischen Errungenschaften. Sie kamen uns so gut wie nie zu Gesicht, mit Ausnahme von einigen Arbeitsgeräten und vereinzelt auch Kleidungsstücken, die wir hin und wieder gegen selbst erzeugte Produkte, vornehmlich Korbwaren, auf Wochenmärkten oder bei umherziehenden Händlern eintauschten.
Geld war uns zwar nicht völlig fremd, aber wir besaßen denkbar selten etwas davon, und wenn doch, so stets in äußerst dürftigen Mengen. Daher hatten unsere Eltern auch nur sehr sporadisch eine minimale Chance, beispielsweise spezielle technische Erzeugnisse, die zeitgemäß waren, zu erwerben, um sie in ihrer kleinbäuerlichen Wirtschaft für einen effektiveren Stoffwechselprozess mit dem vorhandenen geografischen Milieu oder andere Zwecke sinnvoll zu nutzen.
Natürlich besaßen wir Kinder auch keinerlei gekauftes Spielzeug. Langeweile kam trotzdem nicht auf, denn wir konnten uns selber helfen. Not macht bekanntlich erfinderisch. Außerdem hatten wir auch von klein auf regelmäßig bestimmte Pflichten zu erledigen. Und soweit ich mich entsinne (mein Langzeitgedächtnis funktioniert noch recht gut), erschien uns das keineswegs oder nur selten als frustrierend. Es erfüllte uns vielmehr mit sichtlichem Stolz, unseren eigenen Beitrag zum Wohle der Familie leisten zu dürfen, indem wir uns gemäß unserer individuellen Kräfte beispielshalber um die verschiedenartigen Haustiere kümmerten. Da gab es immer reichlich zu tun. Aber wir hatten auch oftmals Freude daran und irgendeinen Nutzen sowieso, bis hin, dass ich später in Deutschland schon mit vierzehn Jahren vollkommen selbstständig war. Dies ist keineswegs übertrieben, was entsprechende Zeugen sicherlich anstandslos bestätigen würden.
All das wird schnell verständlich und daher auch leicht nachvollziehbar, sobald man weiß, dass meine Eltern mit leiblichem Nachwuchs sattsam gesegnet waren. Insgesamt acht Kinder brachte unsere Mutter zur Welt. Zwei davon habe ich freilich niemals gesehen (auch nicht auf einer Fotografie, denn so etwas kannten wir damals noch nicht), weil sie bereits starben, bevor ich als sechster Sprössling geboren wurde.
Bisweilen vernehmen wir die frappierende Mitteilung, dass irgendwo auf afrikanischem Terrain bäuerliche Familien eine gewisse Kinderschar haben müssen, welche eigens im Sinne möglicher Arbeitskräfte gezeugt wird, um dem wenig fruchtbaren Boden gemeinsam zumindest das Notwendigste abzugewinnen, damit sie überleben.
Mit anderen Worten: Sie sind zu arm, sich nur eine geringe Zahl an Nachwuchs leisten zu können, das heißt, als Kleinfamilie würden sie allesamt glattweg verhungern.
Zudem ist uns wahrscheinlich bekannt, dass es innerhalb früherer Sippschaften durchaus vorkam, Alte, Schwache und unheilbar Kranke einfach sterben zu lassen oder mitunter sogar absichtlich zu töten, weil sie zum weiteren Bestand der Großfamilien selbst nichts mehr beitragen konnten und damit letztlich die physische Existenz aller gefährdeten.
Das klingt zwar furchtbar brutal, spielte sich aber in manchen Gefilden teilweise so oder ähnlich ab.
Derart archaisch ging es während meiner Kinderzeit indessen gottlob nicht zu, obwohl wir als Familie weitestgehender Selbstversorgung, abseits von größeren Ortschaften, unser ohnehin kümmerliches Dasein in materieller Hinsicht überwiegend eher schlecht als recht fristeten. Dennoch wäre es falsch zu behaupten, wir hätten niemals das wunderbare Gefühl persönlicher Zufriedenheit verspürt. Allein wenn ich daran denke, wie glücklich wir sein konnten, sobald uns die Mutter ein besonders schmackhaftes Essen bereitete oder uns ein Stück vom Kuchen gab, den sie extra backte, um uns zu erfreuen, wird die naheliegende Vermutung vom ständigen Verhärmtsein, welches uns die mannigfachen Kümmernisse zwangsläufig aufgebürdet haben müssten, bereits widerlegt. Auch wenn wir gewissermaßen nichts zu lachen hatten, war es uns trotzt allem oftmals ein Herzensbedürfnis, es zu tun, mithin wesenseigen. Außerdem streichelten uns die Eltern wiederholt mit einem anerkennenden Blick oder durch ihr aufmunterndes Lächeln, selbst wenn sie die unaufhörlichen Sorgen um das tägliche Brot manchmal fast erdrückten. Die Tugend, mit dem auszukommen, was man hat, und mag es noch so bescheiden sein, fühlt sich offenbar in den Hütten heimischer als in manchen Palästen.
Darüber hinaus konnten wir uns verschiedentlich auch an den jeweiligen Gegebenheiten der äußeren Natur sehr erfreuen, an der Pflanzen- und Tierwelt ebenso wie an Sonne, Mond und Sternen. Schon das fortwährende Spiel der bunten Schmetterlinge, ihr harmonischer Reigen im Lichterglanz, das ständige Umwerben, Foppen und Lieben, ist doch allenthalben eine überaus faszinierende Darbietung. Oder bewusst wahrzunehmen, wie sich zum Beispiel die Knospen bestimmter Blumen von einem Tag zum anderen entfalten, um ihre ganze Pracht zu offenbaren, wirkt sicher gleichermaßen bezaubernd auf unsere Sinne. All das und vieles mehr nahmen wir häufig und gerne in Augenschein, beobachteten es manchmal stundenlang und zehrten lange von den teils verblüffenden Eindrücken.
Wir lebten in einem winzigen Dorf namens Kispuszta (Kleine Puszta) mit insgesamt sechzehn datschenähnlichen Gebäuden, die lediglich aus Holz, Lehm und Stroh errichtet worden sind. Andere Baumaterialien standen uns nicht zur Verfügung. Die Bewohner schufen ihre Katen selbst, wobei sich die Nachbarn gegenseitig halfen. In der spärlichen Siedlung, welche sich obendrein noch auf drei Täler verteilte, wohnten ungefähr achtzig bis neunzig Leute, die sich hauptsächlich von landwirtschaftlichen Produkten aus eigenem Anbau oder teils auch als Wilderer ernährten. Dies war freilich strengstens untersagt, und wehe dem, der sich dabei erwischen ließ, aber man musste sich bei größter Hungersnot, besonders während der Winterzeit, ja irgendwie helfen, selbst mit Wissen um die Gefahr, schlimmstenfalls im Gefängnis zu landen.
Jenes merkwürdige Dörflein, in dem ich meine Kinderjahre verbrachte, befand sich im Süden Ungarns, unweit der Grenze zum ehemaligen Königreich Jugoslawien. Mittlerweile ist es längst geschleift worden, dem Erdboden gleichgemacht, wohl für immer liquidiert. Weg, aus und vorbei! Nur die Erinnerung stirbt nicht.
Der einschlägige Landstrich wurde übrigens auch als „Schwäbische Türkei“ bezeichnet, was unter anderem daran erinnert, dass er einstmals zum Osmanischen Reich gehörte.
Die nächste Gemeinde mit beträchtlich mehr Einwohnern (Abels Wohnsitz!) lag etwa sechs Kilometer von unserer Niederlassung entfernt. Dort wurden zuweilen Entscheidungen gefällt, die auch unsere Angelegenheiten betrafen. Dennoch wusste man meistens kaum etwas voneinander.
Wir vegetierten ziemlich isoliert, aber sehr naturverbunden. Unsere Notdurft verrichteten wir fast immer im Freien, je nach Drang irgendwo auf heimatlichem Boden stehend oder kauernd, meist jedoch auf dem Misthaufen, welcher sich in der Nähe der kleinen Stallungen befand. Als „Toilettenpapier“ benutzten wir Gras, Heu, Blätter oder sonstig geeignete Materialien. Etwas davon war immer da.
Nur während der frostklirrenden und schneegekrönten Monate konnte es recht unangenehm werden. Da trieb es uns doch eher in ein kleines Holzhäuschen, welches unser Vater speziell für solche Zwecke gezimmert hatte. Ansonsten waren wir auch in dieser Hinsicht mehr der Natur zugetan, zumal das stille Örtchen ohnehin meist den Familienmitgliedern weiblichen Geschlechts vorbehalten blieb.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Das Elbmonster»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Das Elbmonster» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Das Elbmonster» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.