Dominanz und Bevormundung
Professionelle Hilfe gründet – anders als die auf Gegenseitigkeit angelegte Hilfe in lebensweltlichen Kontexten – auf einer asymmetrischen sozialen Beziehung zwischen einer helfenden Person und einer Person mit Hilfebedarf (  Kap. 1.3). In dieser Relation sind die Ressourcen für eine wirksame Problemlösung (Fähigkeiten, Wissen, Problembearbeitungstechniken, Zugang zu externen Ressourcen) zwangsläufig ungleich verteilt, anderenfalls läge keine Hilfebedürftigkeit vor. Die strukturelle Überlegenheit birgt das Risiko eines Dominanzverhältnisses, das dazu verleitet, als Expert*in exklusiv über die Angemessenheit von Problemdefinitionen und Lösungswege entscheiden zu wollen und über den Kopf der Adressat*innen hinweg zu handeln. Dies kommt praktisch einer Bevormundung gleich, die auf die Sichtweisen der Adressat*innen und ihre Schwierigkeiten, Probleme zielgerichtet und konsequent anzugehen, keinen Bezug mehr nimmt.
Kap. 1.3). In dieser Relation sind die Ressourcen für eine wirksame Problemlösung (Fähigkeiten, Wissen, Problembearbeitungstechniken, Zugang zu externen Ressourcen) zwangsläufig ungleich verteilt, anderenfalls läge keine Hilfebedürftigkeit vor. Die strukturelle Überlegenheit birgt das Risiko eines Dominanzverhältnisses, das dazu verleitet, als Expert*in exklusiv über die Angemessenheit von Problemdefinitionen und Lösungswege entscheiden zu wollen und über den Kopf der Adressat*innen hinweg zu handeln. Dies kommt praktisch einer Bevormundung gleich, die auf die Sichtweisen der Adressat*innen und ihre Schwierigkeiten, Probleme zielgerichtet und konsequent anzugehen, keinen Bezug mehr nimmt.
Ein bevormundender Handlungsstil kann mit der Begründung legitimiert werden, ein schnelles Vorgehen diene dem Wohl der Adressat*innen und zugleich einer wirksamen Problemlösung, die angesichts der Überforderung oder Unfähigkeit der Betroffenen anders nicht zu erreichen sei. Die Argumentation mit dem Wohl der Adressat*innen entspricht einer paternalistischen Haltung, die ggf. auch Zwangsmaßnahmen legitimiert.
»Paternalismus bedeutet per Definition in jedem Fall einen Eingriff in die Freiheit und Autonomie ohne Zustimmung des*der Betroffenen aus dem ausschließlichen oder vorrangigen Grund, das Wohlergehen der*des Betroffenen bzw. seiner*ihrer Interessen, Werte oder Eigentum zu verbessern bzw. zu erhalten« (Lindenberg & Lutz 2021, S. 74 im Anschluss an Dworkin 2017).
Das Wohl und das wohlverstandene Interesse der Person werden jedoch ausschließlich durch die Sozialfachkraft bestimmt. Die hilfebedürftige Person wird zu deren Handlungsobjekt und ihrer Eigenmächtigkeit beraubt. Auch wenn er die Rechte einer Person noch nicht im Rechtssinne beeinträchtigt, hat der dominant-autoritäre Handlungsstil bereits einen eingreifenden Charakter.
Dass Bevormundung und Dominanz in der Praxis durchaus eine Rolle spielen, zeigen die qualitativen Studien von Heiner (2010) zum beruflichen Selbstverständnis von Sozialfachkräften. Das »Dominanzmodell beruflichen Handelns« ist deutlich durch einseitig negative Haltungen gegenüber den Adressat*innen geprägt. In dieser Haltung erscheinen Adressat*innen als nicht entwicklungsfähig, nicht veränderungsbereit, perspektiv- und willenlos, aggressiv oder destruktiv. Liebenswerte Züge fehlen ihnen ebenso wie Einsichtsfähigkeit. Motivations-, Partizipations- oder Aushandlungsbemühungen erscheinen zweck- und sinnlos.
»Die nicht beeinflussbaren, nicht aushandelbaren, faktensetzenden Aktivitäten der Fachkräfte sind mit massiven Einschränkungen des Handlungsspielraums der Betroffenen verbunden und konstituieren eine Dominanzbeziehung – ohne dass die Fachkräfte ihre Machtposition (…) reflektieren« (Heiner 2010, S. 408).
Hilfe kann folglich die ideologische Formel dafür sein, Menschen, die sich in Obhut der Sozialen Arbeit befinden, durch fragwürdige Maßnahmen der Reglementierung rigider Anpassung zu unterwerfen (»Ich helfe Dir!«). Die von Zwang, Entmündigung und Entwürdigung bestimmte Geschichte der Unterbringung von Menschen mit Behinderung, psychisch Kranken und Kindern und Jugendlichen in Heimen ( 
Kap. 2
) rechtfertigte sich stets mit der moralisch wertvollen Absicht des Helfens und machte sich damit umso schwieriger angreifbar.
Moralische Abwertung und Identitätsbeschädigung
Die moralische Abwertung von Personen mit Hilfebedarf muss nicht in der von Heiner zuvor geschilderter Form auftreten. Schon der Kontakt zu einer Institution der Sozialen Arbeit schließt eine latente moralische Etikettierung ein.
»Eine Diagnose, ein polizeilicher Verdacht oder eine Identifizierung von Vernachlässigung in der Jugendhilfe ist immer eine bewertende Problemzuschreibung an die betroffene Person; es handelt sich nicht um eine rein technische Angelegenheit, sondern immer auch um ein (zumeist negatives) Werturteil über die Person. Bereits die Existenz der Institution und die mit ihr verbundene Lizenz, z. T. weitreichende Eingriffe in das Leben der Klientel vorzunehmen und Änderungen ihrer Ausstattung mit Ressourcen und ihres Status vorzunehmen, beinhaltet das moralische Urteil, dass damit problematische Situationen und Personen bearbeitet werden sollen. Die Kategorisierung und ihre moralische Bewertung sind in den Institutionen also nicht Gegenstand expliziter Entscheidungen durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern Bestandteil des institutionalisierten Doing Social Problems« (Groenemeyer 2018, S. 1506).
Die Adressierung durch Dienste der Sozialen Arbeit konfrontiert Menschen in der Regel mit der Zuschreibung von Hilfebedürftigkeit (jedenfalls so lange Hilfe als geeignete Problemlösung in Betracht kommt). Diese Zuschreibung ist – selbst wenn sie der Selbsteinschätzung betreffenden Person nicht grundsätzlich widerspricht – potenziell mit einer Belastung der personalen und sozialen Identität der Person verbunden. Sie schränkt die Möglichkeiten ein, sich als kompetente Person zu erleben, die mit ihrem Leben selbst zurechtkommt. Adressat*innen müssen anerkennen, dass sie aus behördlicher Sicht als überfordert oder unfähig gelten, selbst wenn die Sozialfachkräfte sorgsam darauf achten, negative Etikettierungen zu vermeiden. Als Hilfebedürftige müssen Adressat*innen Einblick in ihr Leben, die Wohnverhältnisse, ihre Beziehungen etc. geben. Es verwundert daher nicht, wenn Personen mit Hilfebedarf gegen das Vordringen in die Privatsphäre und gegen den Makel der Unfähigkeit innere Widerstände entwickeln und offenkundige Probleme nicht wahrhaben oder Dritten zuschreiben wollen.
Professionell ist ein Hilfebemühen in dieser Situation, wenn offene oder latente Widerstände gegen Hilfeangebote nicht vorschnell als »Ablehnung« und »mangelnde Kooperationsbereitschaft« gedeutet werden. Die mit dem Status einer hilfebedürftigen Person latent bedrohte Identität bedarf einer Vorgehensweise, die Überlegenheitsattitüden vermeidet, das Autonomiebedürfnis der Adressat*innen respektiert, ihnen Gelegenheit zur Aufwertung gibt und sie in ihrer Selbstwirksamkeit aktiv fördert (»Hilfe zur Selbsthilfe«).
»Der springende Punkt ist dabei, ob es gelingt, jenseits der stigmatisierenden Grundkonstellation ein Setting bereitzustellen, in dem Adressat_innen Ansprüche, eigensinnige Deutungen und Lösungsideen geltend machen können, ohne sich wiederum einseitigen oder entfremdenden Definitionen unterwerfen zu müssen« (Bitzan & Bolay 2017, S. 57).
Abhängigkeit statt Ablösung
Hilfe als etwas ›an sich Gutes‹ muss sich gegen das Risiko wappnen, dass sie ungewollt Abhängigkeiten produziert. Abhängigkeiten können entstehen, wenn Hilfen nicht darauf gerichtet oder nicht erfolgreich darin sind, die Selbsthilfefähigkeiten von Menschen zu erweitern oder wiederherzustellen. Die Folgen sind überlange Hilfeverläufe und ein wiederholtes Aufleben des Hilfebedarfs. So wird immer wieder von Familien berichtet, die über viele Jahre und sogar Jahrzehnte von Sozialfachkräften begleitet werden. Es wird zwar Fälle geben, in denen der Hilfebedarf wegen der Art des Problems langfristig angelegt sein muss (z. B. bei einer schwerwiegenden psychischen Erkrankung, die nur begrenzt therapiefähig ist), in anderen Fällen kann hinter Endlos-Hilfen aber eine fragwürdige Helfer*innenrolle stehen. Sozialfachkräfte, die eine mit Dominanzbedürfnissen gekoppelte Expert*innenrolle beanspruchen, tragen dazu bei, dass Adressat*innen eigene Anstrengungen zur Problemlösung unterlassen und sich in eine Konsument*innenhaltung begeben (»Da soll die sich mal drum kümmern!«). Eine solche Haltung ist auch bei überzogener Fürsorglichkeit zu erwarten. Unreflektierte Fürsorglichkeit verletzt den Grundsatz der Hilfe zur Selbsthilfe. Sozialfachkräfte, die Menschen mit Hilfebedarf ›bedienen‹, bedienen nicht selten eigene Bedürfnisse, insbesondere nach Anerkennung und Wertschätzung (zum sog. »Helfersyndrom« Schmidbauer 1998); sie ignorieren und entwerten die Eigenkräfte der Adressat*innen. Am Ende des stellvertretenden Handelns steht nicht die Ablösung, sondern die Abhängigkeit von Hilfe.
Читать дальше
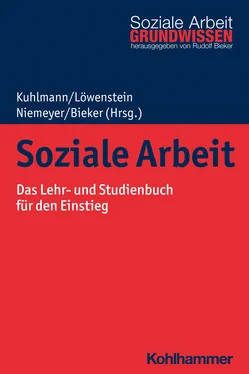
 Kap. 1.3). In dieser Relation sind die Ressourcen für eine wirksame Problemlösung (Fähigkeiten, Wissen, Problembearbeitungstechniken, Zugang zu externen Ressourcen) zwangsläufig ungleich verteilt, anderenfalls läge keine Hilfebedürftigkeit vor. Die strukturelle Überlegenheit birgt das Risiko eines Dominanzverhältnisses, das dazu verleitet, als Expert*in exklusiv über die Angemessenheit von Problemdefinitionen und Lösungswege entscheiden zu wollen und über den Kopf der Adressat*innen hinweg zu handeln. Dies kommt praktisch einer Bevormundung gleich, die auf die Sichtweisen der Adressat*innen und ihre Schwierigkeiten, Probleme zielgerichtet und konsequent anzugehen, keinen Bezug mehr nimmt.
Kap. 1.3). In dieser Relation sind die Ressourcen für eine wirksame Problemlösung (Fähigkeiten, Wissen, Problembearbeitungstechniken, Zugang zu externen Ressourcen) zwangsläufig ungleich verteilt, anderenfalls läge keine Hilfebedürftigkeit vor. Die strukturelle Überlegenheit birgt das Risiko eines Dominanzverhältnisses, das dazu verleitet, als Expert*in exklusiv über die Angemessenheit von Problemdefinitionen und Lösungswege entscheiden zu wollen und über den Kopf der Adressat*innen hinweg zu handeln. Dies kommt praktisch einer Bevormundung gleich, die auf die Sichtweisen der Adressat*innen und ihre Schwierigkeiten, Probleme zielgerichtet und konsequent anzugehen, keinen Bezug mehr nimmt.










