Von erheblicher Bedeutung für die Praxis sind zahlreiche »ethische Antinomien« (Dilemmata), z. B. zwischen Selbstbestimmung-Fürsorge, Nähe-Distanz, Klient*innenwohl-Allgemeinwohl, Loyalität gegenüber Arbeitgebenden-Adressat*innen. Die widersprüchlichen ethischen Anforderungen müssen in konkreten Handlungssituationen immer wieder neu austariert werden, was oft zu erheblichen Unsicherheiten führt (ausführlich und entscheidungsorientierend: Schmid Noerr 2021).
Soziale Arbeit findet weitgehend in Organisationen statt, in Gestalt von Diensten und Einrichtungen der Träger der Sozialen Arbeit (zum Begriff der Organisation: Mund 2019). Träger und Einrichtungsleitungen müssen darauf achten, dass das, was in ihren Diensten und Einrichtungen geschieht, mit ihren Zielen und Mitteln im Einklang steht. Ein Lenkungsinstrument für die Ausrichtung der einzelnen Organisationsmitglieder (Sozialfachkräfte) auf die Organisationsziele sind Leitbilder (»Wer sind wir und wofür stehen wir?«) und (pädagogische) Konzepte. Darüber hinaus können formelle Anweisungen erlassen werden oder informelle Erwartungen bestehen, um bestimmte Verhaltensweisen zu gewährleisten und andere auszuschließen. In katholischen Diensten und Einrichtungen kann es z. B. unerwünscht sein, schwangere junge Frauen ergebnisoffen zu beraten. Die Erwartung an die Sozialfachkräfte kann darin bestehen, sexuelle Betätigungen im Heim möglichst einzuschränken, indem Übernacht-Besuche ausgeschlossen werden. Es kann vorgegeben sein, kirchliche Feste angemessen zu feiern. Es kann »Linie des Hauses« sein, keine Ansprüche zu wecken oder Außenkontakte »aus Sicherheitsgründen« zu begrenzen oder Verlegungen aus Kostengründen (Einnahmeausfall) zu vermeiden.
Wie andere Organisationen auch unterliegen Organisationen der Sozialen Arbeit hierarchischer Steuerung. Allerdings gibt es für eine »Steuerung durch Anweisung« klare Grenzen: Weil Soziale Arbeit durch ihre Fall- und Situationsbezogenheit nur begrenzt standardisierbar und steuerbar ist, müssen die Träger sozialer Dienste und Einrichtungen ihren Fachkräften zwangsläufig Freiräume bei der Ausgestaltung ihrer Aufgaben belassen.
1.4 Funktionen Sozialer Arbeit
Wir haben die Soziale Arbeit in Kapitel 1.1 als personenbezogene soziale Dienstleistung gekennzeichnet. Im Kontext »Soziale Arbeit« geht der Begriff Dienstleistung einerseits über das rein formale Verständnis der Rechtssprache hinaus (Dienstleistung als ein Typus von Sozialleistungen, neben den Geld- und Sachleistungen), andererseits unterscheiden sich Dienstleistungen der Sozialen Arbeit grundlegend von marktförmigen Dienstleistungen (  Kap. 1.1.2:Abgrenzung zu marktförmigen Dienstleistungen).
Kap. 1.1.2:Abgrenzung zu marktförmigen Dienstleistungen).
Im Folgenden sollen nun die Funktionen dieser personenbezogenen sozialen Dienstleistung »Soziale Arbeit« genauer analysiert werden. Seit den 1970er Jahren werden diese mit den Begriffen Hilfe und Kontrolle markiert (Böhnisch & Lösch 1973). Hilfe und Kontrolle stellen das »Doppelte Mandat« der Sozialen Arbeit dar. Der Begriff Mandat entstammt der Rechtssprache; Mandat ist der Auftrag an eine Rechtsvertretung, in einer rechtlichen Angelegenheit die Interessen der sie beauftragenden Person wahrzunehmen.
Soweit Soziale Arbeit als eine öffentlich finanzierte Leistung bereitgestellt wird, hat sie nur einen Mandanten: den Staat (Länder, Kommunen, Sozialversicherungen). Auf dieser Grundlage wendet sich die Soziale Arbeit sodann zwei Adressat*innengruppen zu: dem*der Einzelnen oder einem Kollektiv (z. B. einer Familie) in der jeweiligen Unterstützungsbedürftigkeit auf der einen Seite und der Allgemeinheit auf der anderen Seite. Das Hilfemandat der Adressat*innen ist daher kein originäres, sondern ein sozialstaatlich vermittelter Auftrag.
1.4.1 Soziale Arbeit als Hilfeleistung
Hilfe als Leitcode
Der Begriff, der seit ihren Anfängen wie kein anderer für das »erste Mandat« der Sozialen Arbeit und für ihr Selbstverständnis gestanden hat und nach wie vor steht, ist der Begriff »Hilfe«. Er bildet den »Markenkern« der Sozialen Arbeit und dient vielen ihrer Arbeitsbereiche ausdrücklich als Leitkonzept.
Kinder- und Jugendhilfe, Altenhilfe, Hilfe in besonderen Lebenslagen, Flüchtlingshilfe, Bewährungshilfe, Jugendgerichtshilfe, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, begleitende Hilfe im Arbeitsleben.
Der Begriff Hilfe ist so prominent, dass es nicht verwundert, wenn Studierende ihre Studienmotivation mit »Helfen wollen« beschreiben. Im Helfen-Wollen verbinden sich Altruismus und das Eigeninteresse, einen durch seine Fremdnützigkeit sinnhaften Beruf auszuüben, der materielle Gratifikationen und Karriereoptionen nicht ausschließt, sie aber nicht als Leitmotive in den Vordergrund rückt.
Helfen ist eine zutiefst menschliche Handlung, die sich aus der Nähe und der Beziehung von Menschen zueinander nahezu von selbst ergibt. Helfen können erzeugt auf der Seite der helfenden Person Gefühle von Wertigkeit, Selbstwirksamkeit und Gebrauchtwerden. Helfen hat einen praktischen Nutzen, es verschafft und vertieft soziale Beziehungen und kommt als wechselseitiges Geben und Nehmen allen Mitgliedern einer Gemeinschaft zugute.
Professionelle Hilfe liegt außerhalb und oberhalb von Selbsthilfe und lebensweltlicher Fremdhilfe, wie sie ggf. durch Familie, Verwandte und Freund*innen oder Nachbar*innen und Kolleg*innen geleistet wird. Soziale Arbeit kommt ins Spiel, wenn
• die Natur des Problems, seine Komplexität oder die Verfestigung der Situation ohne professionelle Hilfeleistung nicht auskommt, d. h. die persönlichen oder lebensweltlichen Ressourcen einer Person überfordert sind,
• es keine vorrangig zuständigen anderen Institutionen der Problemlösung gibt (z. B. Kindergarten, Schule) oder deren Zuständigkeitsbereich überschritten wird,
• die Hilfe von der adressierten Person grundsätzlich gewünscht oder zumindest akzeptiert wird, jedenfalls nicht ausdrücklich zurückgewiesen wird,
• der Bedarf an professioneller Hilfe sozialrechtlich anerkannt ist und finanziert werden kann.
Beispiele für die Überforderung lebensweltlicher Hilferessourcen
• Es gelingt hochstrittigen Eltern nach zermürbenden, emotional stark aufgeladenen und von Misstrauen bestimmten Beziehungsverläufen alleine nicht mehr, für die Zeit nach der Scheidung eine tragfähige Zukunftsperspektive für ihre Kinder zu entwickeln.
• Der Heroinsüchtige konsumiert weiter; die Versuche der Eltern, ihn durch gutes Zureden, durch Aufklärung über die gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgeschäden und durch den Hinweis auf das Leiden Dritter (Eltern, Partner*in, Kinder) vom Drogenkonsum abzuhalten, sind gescheitert.
• Es mangelt an Informationen darüber, welche Hilfemöglichkeiten bestehen und unter welchen Voraussetzungen sie genutzt werden können.
• Es fehlt an Fachwissen und methodischen Kompetenzen, um Haushalte mit Mietschulden, fristlosen Kündigungen, Räumungsklagen, drohenden Zwangsräumungen oder in anderen Krisensituationen beraten und sie bei Gesprächen und Verhandlungen mit Vermieter*innen, dem Jobcenter und anderen Institutionen unterstützen zu können.
Dem Hilfemandat der Sozialen Arbeit liegt – soweit diese durch öffentliche Stellen ausgeübt wird oder veranlasst ist – ein gesetzlicher Auftrag zugrunde. Hilfe ist sozialstaatlich gewollt, auch wenn das Sozialstaatsprinzip als solches nur einen schwachen Verfassungsrang hat (  Kap. 5.1.2:Weitere Verfassungsprinzipien). Von einem Hilfemandat der Adressat*innen kann man dann sprechen, wenn diese von ihrem zuerkannten Recht auf Hilfen durch die Gemeinschaft Gebrauch machen und Sozialarbeiter*innen explizit oder stillschweigend mit unterstützenden Leistungen beauftragen.
Kap. 5.1.2:Weitere Verfassungsprinzipien). Von einem Hilfemandat der Adressat*innen kann man dann sprechen, wenn diese von ihrem zuerkannten Recht auf Hilfen durch die Gemeinschaft Gebrauch machen und Sozialarbeiter*innen explizit oder stillschweigend mit unterstützenden Leistungen beauftragen.
Читать дальше
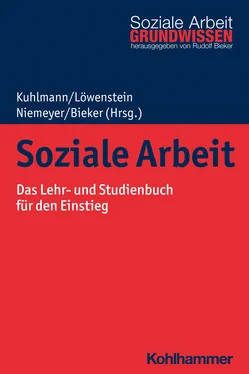
 Kap. 1.1.2:Abgrenzung zu marktförmigen Dienstleistungen).
Kap. 1.1.2:Abgrenzung zu marktförmigen Dienstleistungen).










