Gesetzliche Ansprüche auf personenbezogene Hilfen sind in den einzelnen Sozialgesetzbüchern zu finden (  Kap. 5.1.3:Auffinden von Gesetzen).
Kap. 5.1.3:Auffinden von Gesetzen).
Das SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) gesteht Eltern Hilfe zur Erziehung zu, »wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist« (§ 27 Abs. 1 SGB VIII).
Das Hilfemandat der Sozialen Arbeit, ihr Identitätskern, kommt treffend in der Formel von der »Hilfe zur Selbsthilfe« zur Geltung. Auch wenn der Begriff heute vielen als abgenutzt und altmodisch erscheint, formuliert er ein zeitloses Credo Sozialer Arbeit. Gemeint ist damit nicht jedwede Ausrichtung von Hilfe, sondern eine Hilfe, die auf (Rück-)Gewinnung von Handlungsautonomie zielt. Unter dieser Zielvorstellung kann Soziale Arbeit nicht für ihre Adressat*innen handeln, sondern nur mit ihnen (  Kap. 1.1.2:Aktive Mitwirkung der Adressat*innen). Sie setzt an den Eigenkräften ihrer Adressat*innen an und will sie in den Stand setzen, sich möglichst bald selbst zu helfen. Hilfe ist daher auf das den individuellen Umständen nach Erforderliche beschränkt. Hilfebedarf ist kein Anlass für Bevormundung, fürsorgliche Nötigung und die Enteignung individueller Freiheitsrechte (
Kap. 1.1.2:Aktive Mitwirkung der Adressat*innen). Sie setzt an den Eigenkräften ihrer Adressat*innen an und will sie in den Stand setzen, sich möglichst bald selbst zu helfen. Hilfe ist daher auf das den individuellen Umständen nach Erforderliche beschränkt. Hilfebedarf ist kein Anlass für Bevormundung, fürsorgliche Nötigung und die Enteignung individueller Freiheitsrechte (  Kap. 1.1.1). Hilfe zur Selbsthilfe anerkennt die Fähigkeiten, die es trotz aller individueller Überforderung gibt. Sie respektiert den Willen, nicht mehr als nötig von einer anderen Person oder einer sozialen Einrichtung abhängig zu sein, sie fordert aber auch Eigenaktivitäten ein bzw. will diese als eigene Ressourcen fördern. Die Formel von der Hilfe zur Selbsthilfe hat Bezüge zu modernen Leitlinien der Sozialen Arbeit wie Ressourcenorientierung oder Partizipation. In § 1 SGB I ist die Hilfe zur Selbsthilfe ausdrücklich erwähnt. Dort heißt es: »Das Recht des Sozialgesetzbuchs soll (…) dazu beitragen (…) besondere Belastungen des Lebens, auch durch Hilfe zur Selbsthilfe, abzuwenden oder auszugleichen.«
Kap. 1.1.1). Hilfe zur Selbsthilfe anerkennt die Fähigkeiten, die es trotz aller individueller Überforderung gibt. Sie respektiert den Willen, nicht mehr als nötig von einer anderen Person oder einer sozialen Einrichtung abhängig zu sein, sie fordert aber auch Eigenaktivitäten ein bzw. will diese als eigene Ressourcen fördern. Die Formel von der Hilfe zur Selbsthilfe hat Bezüge zu modernen Leitlinien der Sozialen Arbeit wie Ressourcenorientierung oder Partizipation. In § 1 SGB I ist die Hilfe zur Selbsthilfe ausdrücklich erwähnt. Dort heißt es: »Das Recht des Sozialgesetzbuchs soll (…) dazu beitragen (…) besondere Belastungen des Lebens, auch durch Hilfe zur Selbsthilfe, abzuwenden oder auszugleichen.«
Auch wenn sich der Hilfebegriff zur Markierung der Kernfunktion Sozialer Arbeit durchgesetzt hat, ist er zur Bezeichnung des Territoriums der Sozialen Arbeit nur bedingt geeignet.
Als Begriff des Alltagslebens grenzt er das helfende Handeln akademisch ausgebildeter Fachkräfte nicht gegen das lebensweltliche Helfen ab, wie es durch Familie, Freund*innen und Nachbar*innen geschieht (Laienhilfe). Lebensweltliche Hilfe ist oft gut gemeint, nicht immer aber hilfreich. Wenn Soziale Arbeit auf den Plan tritt, ist in der Regel eine qualitativ höhere Zuwendungsstufe indiziert, die sich in der Allerweltskategorie »Hilfe« nicht abbildet. Helfen kann eben nicht jeder, der dafür persönlich geeignet ist. Persönliche Eignung reicht in dauerhaft belastenden, gefährdenden und krisenhaften Lebenslagen nicht aus, um wirksam Hilfe leisten zu können (Beispiele:  Kap. 1.4.1). Soziale Arbeit erfordert ein breit angelegtes Fachwissen und ein Kompetenzprofil, das nur in einem Studium erworben werden kann und im jeweiligen Arbeitsfeld zu vertiefen ist (Fachbereichstag Soziale Arbeit 2016).
Kap. 1.4.1). Soziale Arbeit erfordert ein breit angelegtes Fachwissen und ein Kompetenzprofil, das nur in einem Studium erworben werden kann und im jeweiligen Arbeitsfeld zu vertiefen ist (Fachbereichstag Soziale Arbeit 2016).
Professionelle Hilfe ist nicht die zum Beruf gemachte Laienhilfe, sondern die durch eine umfassende akademische Qualifizierung geschulte Kompetenz, soziale Probleme wissenschaftlich und fachlich begründet analysieren zu können, um auf dieser Grundlage im Zusammenwirken mit den Problembetroffenen und anderen Fachkräften zielgerichtete, methodisch gelenkte Veränderungen einzuleiten. Die immer noch gestellte Frage »Soziale Arbeit? Muss man dafür studieren?« ist damit eindeutig beantwortet.
Lebensweltliche und professionelle Hilfe trotz der ungleichen Handlungsqualitäten mit demselben Begriff zu belegen (»Hilfe«), wird weder der Sache gerecht noch den berufspolitischen Interessen der Sozialen Arbeit, als akademischer Beruf die ihr zustehende Anerkennung zu finden.
Hinzu kommt, dass der alltagsweltlich geprägte Begriff Hilfe die funktionale Differenzierung der Berufsrolle von Sozialarbeiter*innen nicht deutlich werden lässt. Tatsächlich sind mit der Rolle vielfältige Funktionen gekoppelt, die fallbezogen, feldbezogen, organisationsbezogen und systembezogen zum Einsatz kommen. Der Hilfebegriff hat vor allem fall- und feldbezogenes Handeln im Visier, organisationsbezogene Funktionen (Führen, Leiten, Mittelbeschaffung, Qualitätsmanagement) oder systembezogenes Handeln (politische Mitwirkung und Einflussnahme) blendet der Leitcode Hilfe dagegen aus. Er setzt professionelle Hilfe nicht nur mit Laienhilfe gleich (s. zuvor), sondern übergeht zugleich die Vielfalt der Funktionen, die mit der Berufsrolle verbunden sind.
Schließlich verdeckt Hilfe als Chiffre für das Selbstverständnis und die Selbstpräsentation der Sozialen Arbeit, dass Soziale Arbeit nicht nur einen Adressaten hat, sondern zwei: Sie arbeitet nicht nur im staatlich vermittelten Auftrag der Gesellschaft, sondern sie ist auch Interessenwalterin der Gemeinschaft, und zwar dort, wo die*der Einzelne zentrale Erwartungen der Gemeinschaft verletzt, Individuum und Gesellschaft also in ein Spannungsverhältnis geraten ( 
Kap. 1.4.2 1.4.2 Soziale Arbeit als soziale Kontrolle Bis hierin sind wir im Wesentlichen davon ausgegangen, dass die Kernaufgabe Sozialer Arbeit darin liegt, Menschen bei der Bewältigung belastender und überfordernder Lebenslagen zu unterstützen. Diese Hauptfunktion, das Hilfemandat, beruht auf Grundentscheidungen der Verfassung, die mit Begriffen wie Menschenwürde, freie Entfaltung der Persönlichkeit, dem Gleichheitsgebot und dem Sozialstaatsprinzip verbunden sind ( Kap. 5.1.2: Weitere Verfassungsprinzipien). Gegenstand der personenbezogenen Dienstleistungen sind aber nicht alleine individuelle, wie auch immer entstandene »Notlagen«, sondern auch – so bereits die Feststellung in Kapitel 1.3.2 – diverse Formen abweichenden Verhaltens (z. B. innerfamiliäre Gewalt). Abweichendes Verhalten ist zumeist kein Problem für die Person, die sich abweichend verhält, sondern ein Problem für ihre soziale Umgebung und die Gesellschaft insgesamt einschließlich ihrer Rechtsordnung. Wenn Sozialfachkräfte im Zusammenhang abweichenden Verhaltens tätig werden, geht es folglich nicht um ein Hilfebedürfnis der*des Einzelnen, sondern um das Interesse der Allgemeinheit, bestimmte Formen der individuellen Lebensführung nicht zu tolerieren. Die Tatsache, dass personenbezogene soziale Dienstleistungen einen zweifachen Adressaten haben (können), bezeichnet man als »Doppeltes Mandat« der Sozialen Arbeit (zuerst Böhnisch & Lösch 1973). Doppeltes Mandat bedeutet: Soziale Arbeit steht Menschen nicht nur bei, sie tritt ihnen auch als Repräsentantin der Gesellschaft gegenüber.
).
Risiko- und Problemzonen des Helfens
Menschen beizustehen, die sich in einer inneren oder äußeren Notlage befinden, hat den Anschein des Guten und des Wohltuenden. Herrmann (2015, S. 128) spricht von der »moralischen Codierung« von Hilfe. Doch ist das, was als Hilfe firmiert, immer gut? Und wird sie von ihren Adressat*innen gewünscht und wertgeschätzt?
Der Weg, anderen Menschen zu helfen, führt zumindest durch einige Risikozonen.
Читать дальше
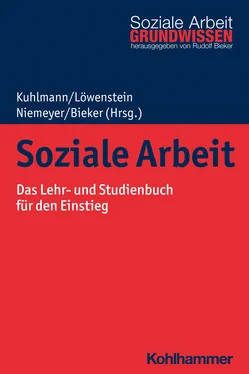
 Kap. 5.1.3:Auffinden von Gesetzen).
Kap. 5.1.3:Auffinden von Gesetzen).










