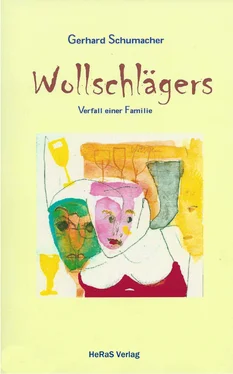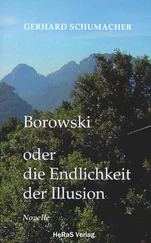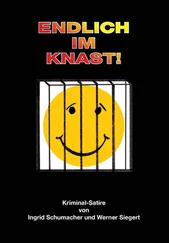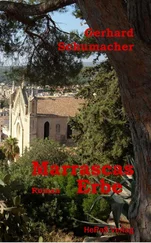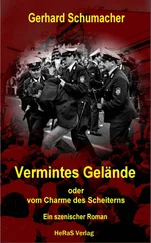Zu den besseren Zeiten, als das Erika noch den Bembel schwang, hatte er gut und gerne vier bis fünf Gespritzte am Abend getrunken, manchmal noch ein bis zwei Biere und, an den Wochenenden, schon mal den ein oder anderen Apfelkorn zwischendurch. Doch diese Zeiten waren, im Moment wenigstens, vorbei und der Referendar haderte mit seinem Schicksal und dem seiner großen Liebe, von der er genauso wenig wie die Eltern wusste, wo sie abgeblieben war.
Er fragte sich natürlich, inwieweit ihn selbst ein Teil der Schuld betraf, die zu Erikas Exodus führte. War er gar zu stürmisch, fordernd, besitzergreifend, oder, im Gegenteil, war es zu wenig gewesen? Sollten alle im Überschwang der Wollust gestammelten Schwüre und Beteuerungen, Aufforderungen, mehr und immer schneller mehr zu geben, nichts als Lippenbekenntnisse in der feuchten Schwüle zwischen Frotteelaken und Federbett gewesen sein?
Gleich den Eltern Wollschläger hatte sich auch der Referendar Wildgruber eine andere Zukunft erträumt als die, die jetzt als unabänderliche vor seinem geistigen Auge herumgaukelte. Wenn das Referendarwesen auch sein Beruf, niemals aber seine Profession war, strebte er doch nicht zu Höherem, sondern viel eher noch zu beschaulicherem Tun.
Die Hochzeit mit dem Erika, in naher Weile schon in seinem Kopf geplant, schien ihm wünschenswert, dem staubigen Alltag im Amtsgericht wollte er entsagen und sich stattdessen gänzlich der Pflege hessischer Gastfreundschaft widmen, ein, zwei Kinder zeugen, auf das seine Nachfolge gesichert sei, dem Schwiegervater das Altenteil, das verdiente, verschönern und ganz in seiner Rolle als Wirt des Gasthofs Wollschläger, als Ehemann, als Vater, aufgehen.
Ein jeder an seinem Platz.
Dieserart trübsinniger Gedanken nachgrübelnd nahm der Referendar sein Glas mit Äbbelwoi in die Hand, trat an das Fenster der Wirtshausstube und blickte versonnen auf die Gasse davor, in der ein reger Verkehr von herumschlendernden Fußgängern herrschte, die das schöne Wetter zu einem Bummel durch die Altstadt nutzten.
Da kam auf dem schmalen Trottoir ein kleinwüchsiges, äußerst dünnes Männchen des Wegs, das trotz der angenehmen Temperaturen einen dicken Wintermantel wollähnlicher Machart von unbestimmter Farbe, am ehesten ließ sich noch ein bräunlicher Ton vermuten, und auf dem Kopf eine im Volksmund abwertend als Batschkapp deklarierte Bedeckung trug. Die Denkwürdigkeit der Erscheinung wurde durch eine rechtsseitig getragene Aktenmappe gerundet, deren rissiges braunes Leder auf ein weit zurückliegendes Produktionsdatum deutete, zumal das Modell als solches heutzutage nur noch in gut sortierten Antiquitätengeschäften mit entsprechender Spezialisierung anzutreffen, selbst für den kenntnisreichen Fachmann als glücklicher Zufall eingestuft werden dürfte.
Diese Erscheinung nun sprang, immer wenn ein vermeintlicher Bekannter ihr entgegenkam mit beiden spindeldürren Beinchen derart in die Luft, wie es Balletttänzer zu tun pflegen, wenn sie eine Pirouette zu drehen sich anschicken und riss gleichzeitig mit der freien Linken seine Kappe vom Haupt, dass das schüttere Kopfhaar unvorteilhaft, und in seinen wenigen Strähnen zerzaust, sichtbar wurde. Dabei weitete er seine Lippen von der einen zur anderen Ohrenseite zu einem Lachen der offensten Art, das zwei Reihen blitzblanker, vielleicht der Kunst eines versierten Prothesenherstellers zu verdankender Zähne sichtbar wurden, die an Rein- und Freundlichkeit nichts zu wünschen übrig ließen.
Durch die spirrligen Drehungen der Beinchen und des Kopfes vollführte das Männlein in der Luft eine Viertelrotunde, die ihn quer zur Laufrichtung mit einem Fuß auf dem Kopfsteinpflaster des, freilich nicht von Kraftfahrzeugen genutzten, Fahrdammes auf den Erdenboden beorderte, was er aber durch geschicktes Beugen der Kniegelenke auszugleichen verstand. Das Ganze hinterließ einen durchaus unterhaltsamen, ja komischen Eindruck und wiederholte sich in kurzen Abständen.
Der Wirt war hinter den Referendar getreten, zu schauen, was es denn Interessantes auf der Gasse zu sehen gab, bemerkte das Männlein und verzog sein grämliches Gesicht zu einer Grimasse, die trotz seines Kummers wohl ein Lächeln ausdrücken sollte.
"Ach de Zeisisch Willi, schau an", ließ er vernehmen und begab sich zurück hinter den verwaisten Tresen, mit einem Lappen die Zapfhähne zu polieren, wie er es schon seit geraumer Zeit tat. Auch der Referendar Wildgruber setzte sich wieder auf seinen Platz am Stammtisch, den ein blankes Messingschild an dem von zwei geschmiedeten Halterungen hängenden Kettchen, über einem großen runden Aschenbecher aus Glas befestigt, als solchen auswies.
Es fehlte ihm die rechte Freude an den Darbietungen vom Zeisig Willi, der bei seinem verhinderten Schwiegervater offensichtlich wohl bekannt und gelitten war.
Ein Geräusch von der Gaststubentür und das Blähen des ledernen Windfangs kündigten die Ankunft eines neuen Gastes an und tatsächlich betrat ein groß gewachsener Mann, wohl Mitte der Fünfziger, den Schankraum, querte ihn bis etwa zur Mitte, blieb stehen, drehte dann einmal langsam um die eigene Achse, einen Überblick von Einrichtung und Anwesenheit sich zu verschaffen und schritt schweren Tritts auf die hohen Lehnhocker am Tresen zu, wo er schließlich auf einem derselben Platz nahm.
Auch er trug, gleich dem Zeisig Willi, ungeachtet der sommerlichen Außentemperatur einen langen, vorne offenen, Wintermantel, der aus schwerem, dunkelgrünen Leder gearbeitet war, durch einen breiten, taillenseitig angebrachten Gürtel aus eben demselben Material verziert wurde und gerade so weit an ihm herunterreichte, dass er nicht den Boden berührte. Mit einer einzigen geschickten Bewegung des rechten Arms schwang er den Rockschoß des Mantels über die Hockerlehne, erkundigte sich bei dem Wirt Wollschläger mit lauter Stimme, was denn in diesem Landstrich am meisten getrunken würde und bestellte dann, ohne eine Antwort abzuwarten, ein großes Bier, "aber vom hiesigen, bitte".
Der Wirt beeilte sich, dem Wunsche nachzukommen und kaum, dass der Fremde das einheimische Bier in Empfang genommen hatte, leerte er das Glas mit einem anhaltenden Schluck zu gut zwei Dritteln und stellte es behutsam auf dem Tresen ab. Dann wischte er sich mit dem Handrücken den Bierschaum aus dem voluminösen Schnurrbart, der von dem gleichen Schwarz war wie sein überaus volles, nach allen Seiten abstehendes Kopfhaar und schnaubte behaglich vor sich hin. Kurz darauf leerte er auch den im Glas verbliebenen Rest, schnaubte wiederum, diesmal anerkennend, und begehrte vom Wirt zu wissen, was denn das für ein Bier sei.
"Des is Euler, se könne abä aach Waldschmidt habbe, allerdings nur in de Flasch", antwortete Wollschläger und schenkte das Glas, nachdem der Fremde auf frisch gezapften Gerstensaft bestanden hatte, erneut ein.
So ging das eine gute Weile und der Referendar fing an, sich zu wundern, welche Biermengen der Fremde schon am frühen Abend zu verinnerlichen in der Lage sich zeigte.
Im Verlaufe der Zeit drehte sich dieser auf seinem Lehnenhocker zu Wildgruber um, der zum besagten Zeitpunkt neben dem Fremden der einzige Gast in der Wirtsstube war und verkündete ihm und dem Wirt selbst mit dröhnender Stimme, dass er Harms hieße, aus dem Lauenburgischen nicht nur stamme, sondern daselbst auch ansässig sei, genauer gesagt in einem unscheinbaren Ort namens Berkenthin, und geschäftlich im Dienste des Posamentiergewerbes im Hessischen unterwegs sei. Es handele sich dabei um eine sehr alte Kunst, die ihren Ursprung im erzgebirgischen Annaberg habe und zu Unrecht fast der Vergessenheit anheimgefallen sei. Er, Harms, jedoch habe es sich zur Aufgabe gemacht, eben diesen Posamenten wieder jenen Platz zukommen zu lassen, der ihnen gebühre, dem industriellen Machwerk zum Trotz. So habe es ihn nach Wetzlar verschlagen, hier mit seinem guten Werk zu beginnen, dann Hessen insgesamt und später die übrigen deutschen Landstriche zu beglücken.
Читать дальше