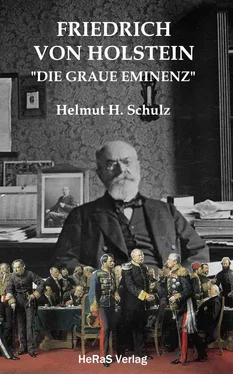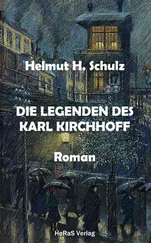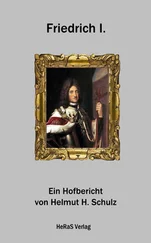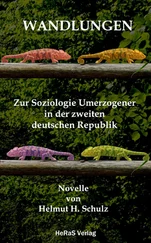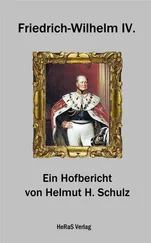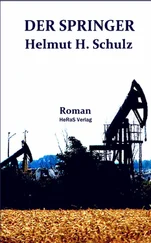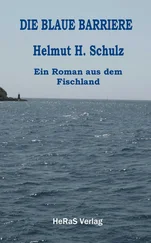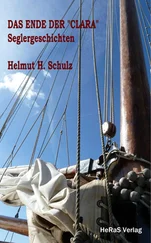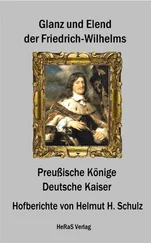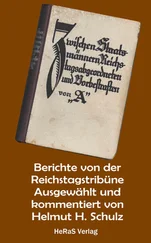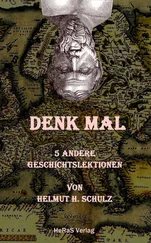Die Äußerung seines ehemaligen Staatssekretärs von Tschirschky, nunmehr eine Exzellenz und Botschafter, am Heiligabend 1914 in der Halle des »Hotel Panhans« auf dem Semmering lesen sich ganz anders. Holstein war tot und auch Bülow nicht mehr am Leben, sodass der Botschafter als einzig noch lebender Zeuge gelten kann, er mag diese Betrachtung schließen. »Auf Ihre Frage, warum ich beim Sturze Holsteins mitgewirkt habe, muss ich Ihnen antworten: weil ich ihn für einen Schädling hielt, für einen Mann, der vielleicht ins Mittelalter oder in die Renaissance gepasst hätte, nicht aber mehr in unsere Zeit. Holstein war immer in der Maske des Verschwörers. Er blieb unterirdisch und lichtscheu, weil er vor der Masse sich nicht bewegen konnte und überdies ein sehr schlechter Redner war. Ich habe ihn immer für moralisch abseitig gehalten, er konnte mir nicht in die Augen sehen. Oft schien er mir wie ein zitternder Knecht. Seine Art, sich zu geben, ermöglichte die Legendenbildung um ihn: Er wurde zeitlos. Ich habe niemals wieder im Auswärtigen Amt so verschreckte Diener mit verängstigten Mienen gesehen, wie jene, die Holstein zu bedienen hatten. Sie zitterten buchstäblich vor ihm und wagten in seiner Gegenwart nur zu flüstern. Aber diesen Schrecken jagte er allen Leuten ein. Ich habe ganz ernsthafte Männer gekannt, wie zum Beispiel Radowitz und Pückler, die aus seinem Zimmer, wie nach einem erhaltenen Keulenschlag, herauskamen.«
Zweiter Teil: DER UNTERNEHMER
»Ich habe«, schreibt Holstein an seine Vertraute Helene, Frau von Lebbin, »den zweiten Teil des „Faust“ wieder einmal gelesen und bin frappiert über die Ähnlichkeit, die stellenweise zwischen dem dortigen Kaiser und unseren herrscht. - Unser behandelt das Regieren auch als Sport. Ob er wohl auf dem Thron stirbt? - Er ist nicht der richtige Mann, und es ist nicht die Zeit, um mit dem Volk wie mit einem Riesenspielzeug umzuspringen. Ich glaube eher an die, jetzt schon von Bismarck, vorbereitete Republik, als an den Zerfall des Reiches«. Anlass für diese Notiz war der Besuch Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. in Bonn, das heißt, dem Korpshaus der Verbindung der Borussen. Holsteins Gewährsmann, der dortige Pedell, berichtete ihm von einer Maskerade, an der Seine Kaiserliche Hoheit teilnahm, dass er in der Couleurjacke der Burschenschaft durch die Bonner Lokale zog, um einen Grafen Rex zu verabschieden und ihn an die Bahn zu geleiten. So geschehen 1891, dem Jahr der Entlassung Bismarcks. Und der Text, auf den Holstein anspielt, liest sich überraschend aktuell: »So sei die Zeit in Fröhlichkeit vertan! Und ganz erwünscht kommt Aschermittwoch an. Indessen feiern wir, auf jeden Fall, nur lustiger das wilde Karneval.« (Faust II. 5060) »Gestern in der Bierjacke, heute im Hermelin«, fügt Holstein lakonisch hinzu. Er hätte auch ein anderes Zitat finden können: »Wir wollen alle Tage sparen und brauchen alle Tage mehr«, so die Klage des Marschalk im Drama. Und der Schatzmeister sekundiert: »Die Goldespforten sind verrammelt, ein jeder kratzt und scharrt und sammelt und unsere Kassen bleiben leer.« (Faust II, 4850)
Soweit die Dichtung; zurück zur Wirklichkeit. Das Kaiserreich stand nach dem siegreichen deutsch-französischen Krieg ökonomisch besser denn je da. In dieser Periode, zeitlich sogar vor dem deutsch-französischen Krieg, hat Holstein versucht, sich in der Wirtschaft seinen Platz zu sichern. Es war vielleicht ein Versuch, der lästigen Beamtentätigkeit zu entrinnen, und es sollte bei nur einem Versuch bleiben. Er trat in den Aufsichtsrat einer Kapitalgesellschaft, der Tauschifffahrtsgesellschaft, ein, setzte dabei allerdings, anders als manch einer seiner Kollegen in Amt und Würden, sein Privatvermögen aufs Spiel. Staatliche Mittel nahm er nicht in Anspruch; auf legalem Wege hätte er auch keine erhalten. Einst hatte die Familie Holstein bessere Tage gesehen und ein »großes Haus« in Berlin, in der Prachtstraße »Unter den Linden«, geführt. Friedrich, der Erbe musste es verkaufen und erhoffte sich nun durch die Geldanlage in einem Wirtschaftsunternehmen größere Unabhängigkeit; er blieb jedoch Beamter, vorläufig beurlaubt. Mit einem Rest an Möbeln aus dem Palais hatte er seine Mietwohnung in der Großbeerenstraße 40 ausgestattet. Um seinen Plan zu verwirklichen, musste sich der Legationsrat Friedrich von Holstein vom Amt freistellen lassen, zunächst für ein Jahr, um in dem Aufsichtsrat der oben erwähnten Gesellschaft tätig zu werden, wozu er die Erlaubnis seines Vorgesetzten einholen musste, also Bismarcks. Beraten von seinem Bankier Meyer-Cohn, legte er Geld an; spezielle technische Kenntnisse in Sachen Schifffahrt und Transportwirtschaft brachte er nicht ein. Die vorerst für ein Jahr ruhende Beratertätigkeit beim Außenministerium dürfte er doch nicht ganz eingestellt haben, wenn ihm auch seine Beamtenbezüge fehlten; er ging ein Risiko auf Zeit und auf gut Glück ein, aber er war keine Spielernatur und ihm fehlte auch das Zeug zu einem Kapitalisten. Geschäftsführer der Gesellschaft war der Bankier Meyer-Cohn. Kurz gesagt ging es bei dem Unternehmen um die Verbesserung der Rheinschifffahrt. Weshalb sich Holstein gerade für diesen Zweig der Transportwirtschaft entschied, darüber gab er keine Auskunft. Man kann aber vermuten, dass er als Kind in Schwedt die Kähne auf der Oder gesehen und beobachtet hatte, vielleicht war Zufall im Spiel, oder sein Bankier hatte ihm zu dieser Anlage geraten. Obschon er keine Ahnung von der Rheinschifffahrt besaß, versprach er sich offenbar auf längere Sicht Gewinn aus der Sache; es war kein Luftschloss, an dem er baute. Das im neumärkischen Schwedt an der Oder gelegene Gut Trebenow seines Vaters hat Holstein nicht bewirtschaftet; er war kein Landwirt, allerdings noch weniger Schiffer oder ein mit Wasserfahrzeugen vertrauter Techniker. Was Trebenow betrifft; die Rede ist von einer Schafherde, die bei einem Großbrand vernichtet wurde. In einer Lesart hat der junge Holstein in Berlin davon erfahren und immer die verkohlte Leiche seines Vaters vor Augen gehabt; nach anderer ist er selbst Augenzeuge der Brandkatastrophe gewesen. Der Leichnam des alten Holstein war bis zur Unkenntlichkeit verkohlt, als er unter dem einstürzenden Dach des Brandes zu liegen kam. Die erste Version ist die wahrscheinlichere. Holstein erfuhr von dem tragischen Unfall als Student in Berlin. Die Mutter, eine geborene Brünnow, hatte ihrem Sohn wie schon erwähnt »Unter den Linden 3 a« ein ansehnliches Stadtquartier hinterlassen; ansehnlich ja, aber nur unter anderen Verhältnissen rühmens- und erhaltenswert. Holstein konnte das Haus nicht erhalten, sich aber wenigstens einer guten Erziehung erfreuen. Er war zum Juristen ausgebildet und für die Zeiten auch gebildet.
Am 04. April 1837 zu Schwedt an der Oder geboren, hatte er mit Lob und Anerkennung das Gymnasium absolviert. Dort waren ihm bescheinigt worden, erstens ungewöhnliche Kenntnisse in französischer und in englischer Sprache; er dürfte auch in den Altsprachen unterrichtet worden sein. Latein und Griechisch gehörten zu den Pflichtfächern einer humanen Bildungsstätte. Hervorgehoben wird zweitens, dass er sich schon als Schüler an die Übersetzung von Buchtexten aus dem Englischen ins Deutsche versuchte. Dies fand Anerkennung. Die französische Sprache soll er in hohem Maße beherrscht haben, in Wort und Schrift; französisch war die Diplomatensprache des Zeitalters. Auch wenn es unterdessen reformierte höhere Lehranstalten gab, die den technisch-wissenschaftlichen Nachwuchs ausbildeten; Holstein war an einer der klassischen humanistischen Bildungsstätten auf das Leben vorbereitet worden. Dank seines Interesses für Geschichte konnte er sich ein Weltbild erarbeiten, das heißt, sich etliches Wissen in Universalgeschichte aneignen, wie ihm drittens bestätigt wurde. Was ist sonst noch über diese Zeit und über ihn bekannt? Nicht viel, man darf spekulieren. An dem jungen Pennäler wird die Revolution von 1848 nicht spurlos vorübergegangen sein; mehr als eine Warnung vor dem randalierenden Pöbel blieb nicht hängen. Bei den Märzereignissen in Berlin zählte er elf Jahre, als sich der preußische Konservative Otto von Bismarck der verwaisten preußischen Königin Augusta in Babelsberg als Helfer anbot und sich ihr zur Verfügung stellte, sollte die Monarchie in Gefahr kommen. Der Gatte Augustas, der spätere Kaiser, Wilhelm I., der Kartätschenprinz, weil er auf die berliner Rebellen schießen ließ, sodass er selbst in der Familie viel an Rückhalt verloren hatte, war flüchtig und galt vorerst als verschollen. Niemand wusste, ob und wann er je nach Preußen zurückkehren konnte, falls er nicht als Emigrant im Londoner Asyl blieb, das er auf einigen Umwegen, als Kaufmann getarnt, erreicht hatte. In der Tat beschäftigten sich die liberal gestimmten Kreise der Konservativen mit verschiedenen Entwürfen für eine Erneuerung des Regimes, vielleicht eine konstitutionelle Monarchie; so ist wenigstens für eine Minderheit der späteren »Neuen Ära« anzunehmen. Es kam anders; wie jede Revolution, verfehlte auch diese ihr ursprüngliches Ziel. Bei dem zwischen Verzweiflung und Hoffnung um Fassung ringenden Wilhelm IV. konnte niemand vorhersagen, bis zu welchen Zugeständnissen er gehen würde; mit der grimmigen Bürgerwehr vor dem Schloss, schien die Monarchie am Ende. Viele rechneten mit seiner Abdankung, mit seinem Thronverzicht und der Umwandlung Preußens in einen Staat nach englischem Vorbild, eine der heißesten Wünsche Augustas. Alles schien möglich, selbst die Republik; auch wuchsen die großdeutschen Vaterlandsträume wunderbar auf; das Frankfurter Vorparlament richtete sich in ein neues Kaisertum ein, unter Führung Preußens. Man hatte schon eine Verfassung, nur noch keinen Kaiser. Das ganze Deutschland sollte es sein! Wir sind ein edles Volk und verdienen alles Glück der Erde, schrieb man zu Frankfurt.
Читать дальше