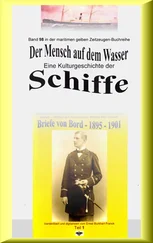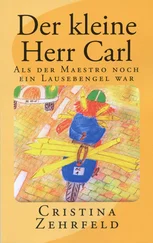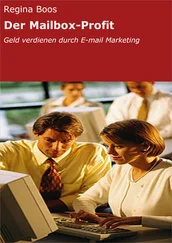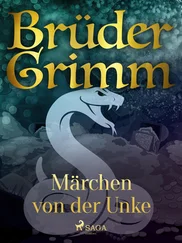Sonntags zum Kaffee wurde der Kuchen dann verspeist. Zu besonderen Anlässen backte sie Frankfurter Kranz und Mohnkuchen. Den mochten die Brüder unserer Mutter besonders gerne. Diese Onkel waren oft bei uns zu Besuch, wie auch zwei Schwestern von Opa Joseph, dem Vater unserer Mutter. Das Schönste am Backen war, dass anschließend die Schüsseln ausgeschleckt werden durften. Am ergiebigsten waren die Schüsseln, wenn Topfkuchenteig oder Tortenfüllungen zubereitet worden waren. Wir Kinder wollten dann alle schlecken und mussten uns einigen, mit wem wir uns eine Schüssel teilen wollten. Beim anschließenden Abwaschen war es unsere Aufgabe, abzutrocknen.
Auf die Schule freute ich mich. Die war auch viel näher an unserer Wohnung als der Kindergarten. Zur Schule musste ich nur über die Straße gehen.
Anfang April 1955 wurde ich in die zweiklassige Dorfschule eingeschult. In unserem Klassenraum war die erste und zweite Klasse. Zwischen diesem Klassenraum und dem Klassenraum der höheren Klassen lag der Schulhof.
Erst als ich in die Schule kam, fiel mir auf, dass die Bekleidung, die mir zu klein geworden war, später meine jüngeren Schwestern trugen. Bei meinen Geschwistern war das auch mit den Schuhen so.
Meine Schuhe konnten aber von meinen drei Geschwistern nicht „nachgetragen“ werden. Sie waren unterschiedlich groß, und es waren Stiefel, die niemand anders freiwillig angezogen hätte. Wenn ich neue Schuhe bekam, kosteten sie viel Geld, das hatte ich mitbekommen.
Jedes Paar meiner Schuhe konnte einmal „vorgeschuht“ werden, das heißt, durch ein neues, längeres Vorderteil wurde der Fußteil des Stiefels verlängert. Dafür mussten wir dann wieder in die Großstadt fahren, in die Klinik mit der Orthopädie- Schuhmacherei. Die Schuhe blieben dann in der Werkstatt, und ich fuhr in Hausschuhen zurück. Bis die Schuhe fertig waren, das konnte acht bis vierzehn Tage dauern, musste ich im Haus bleiben und konnte nicht rausgehen, denn die Hausschuhe gaben mir keinen richtigen Halt. Ersatzschuhe hatte ich nicht. Aber bekam ich meine Stiefel zurück, sahen sie wie neu aus. Sie waren wenigstens nicht mehr so abgewetzt – so ärmlich.
Wenn die Stiefel mir nicht mehr passten, mussten sie weggeworfen werden. Ich hatte deshalb oft ein schlechtes Gewissen.
Gekaufte Halbschuhe, die hätte ich auch gerne gehabt. Aber nicht auszudenken! Schuhe – nicht rotbraun, sondern ganz normal, in Rot oder Hellbraun oder gar zweifarbig... Meine Schuhe waren jahrelang rotbraun und so, dass andere auf zehn Meter Entfernung erkennen konnten, dass ich Maßschuhe trug. – Überhaupt nicht schick!
Mein Vater hatte in einer benachbarten Kleinstadt eine Arbeitsstelle als Maschinenschlossermeister bekommen. Als meine Eltern im Sommer 1955 eine größere Wohnung in dieser Stadt bekamen, zog die Familie dorthin um. Unsere neue Wohnung befand sich über der Landmaschinenfirma, in der mein Vater arbeitete. Sie hatte drei Zimmer, Küche und Bad, einen langen Flur mit Einbauschrank, einen großen Dachboden, auf den man über eine Ausziehleiter gelangte, und einen Kellerraum. In dieser Wohnung wurde mit einzelnen Öfen
geheizt. Im Kinderzimmer stand ein Ofen, im Wohnzimmer ebenso. In der Küche gab es einen Küchenherd, der mit Holz und Brikett befeuert wurde, und einen elektrischen Küchenherd. Im Badezimmer waren ein Wandstrahler und ein Heißwasserboiler, die vor dem Baden angestellt wurden. Im Schlafzimmer meiner Eltern gab es keine Heizmöglichkeit.
Auf dem Dorf hatten wir auf der „Hühnerwiese“ oder auf der freien Fläche des Bauernhofs gespielt, in der Stadt spielten wir in den Trümmern. Vor dem Gebäude der Landmaschinenfirma lagen die Ruinen eines großen Wohnhauses, das im Krieg zerstört worden war. Nur das Kellergeschoss war erhalten, die Decke fehlte. Es bestand aus unterschiedlich großen Räumen. In einem dieser Räume stand eine Holzkiste, die mit Sand gefüllt war. Ein kleiner Raum war als Toilette für die Männer der Firma ausgebaut und auch überdacht worden.
Wir Kinder konnten über eine Leiter in die Ruine hinabsteigen und dort spielen. War das Wetter nicht für Außenspiele geeignet, konnten wir vom Kinderzimmerfenster aus auf den Hof schauen. Da standen Trecker, Mähdrescher oder andere Landmaschinen, die repariert wurden. Besonders spannend war es, wenn ein Lanz-Bulldog angelassen wurde. Erst wurde er mit einem Schweißbrenner angewärmt und dann vorn angekurbelt.
Wie die Geräusche des Motors erst schwerfällig klangen und dann immer schneller wurden, war interessant. Wir Kinder wussten auch bald, wann der Motor des Bulldogs es schaffte. Gab er nicht die richtigen Töne von sich (lief er noch nicht richtig rund), ging er wieder aus, wurde wieder angewärmt und wieder gestartet. Jedes Mal ein tolles Erlebnis.
Gelegentlich wurden auch neue Mähdrescher angeliefert, die den Schriftzug der Landmaschinenfirma bekamen. Diese Arbeit machte ein Maler, der eine starke Schüttellähmung hatte. Wir Kinder sahen vom Fenster aus gespannt zu, denn so heftig dieser Mann auch zitterte, er traf immer die richtige Stelle, um den Schriftzug zu vervollständigen.
Eine andere wichtige Besonderheit war, dass wir in der Nähe des Güterbahnhofs lebten. Alle „großen Dinge“ kamen an unserem Haus vorbei. Waren Manöver angesetzt, wurden die Panzer auf dem Güterbahnhof verladen und fuhren vor und nach den Übungen an unserem Haus vorbei. Dann klirrten sämtliche Gläser in den Schränken. Aber noch interessanter war es, wenn ein Zirkus angekündigt war. Vor unseren Fenstern wurden Pferde, Ponys, Kamele, Lamas und Elefanten vorbeigeführt und viele Zirkuswagen mit Unimog oder Bulldog vorbeigezogen.
Im Dorf hatte ich einen Schulweg von nur einer Minute gehabt – nur schräg über die Straße. In der Kleinstadt musste ich weit laufen. Es war eine große Schule, sechszügig, und jede Klasse – mit mindestens doppelt so vielen Schülern wie in der zweiklassigen Dorfschule – hatte ihren eigenen Klassenraum.
Meine Eltern hatten immer einen Garten, in dem Obst und Gemüse angebaut wurde. Im Dorf waren wir mit einem kleinen Leiterwagen in unseren Garten gefahren. Unser erster Garten in der Kleinstadt lag in einer Gartenkolonie etwa 3 km von unserer Wohnung entfernt und war gut mit Fahrrad oder Bus erreichbar.
Ich kann mich noch an Busfahrten erinnern, bei denen mich fremde Erwachsene aufforderten, den Sitzplatz für sie frei zu machen. Wenn er in der Nähe war, kam mir mein Vater zu Hilfe und klärte die Leute mit leiser Stimme auf, dass ich nicht stehen könne, weil ich was am Bein hätte. Ich brauchte nie aufzustehen, aber ich fühlte mich dabei auch nicht wohl. Ich hatte den Eindruck, dass meinem Vater die Situation peinlich war. – War ich ihm auch peinlich? Wurden Familienfotos gemacht, wurde mir immer gesagt, wie ich mich hinzustellen hatte, damit man „das Bein“ nicht so sah. Damit war für mich deutlich, dass meinen Eltern mein linkes Bein irgendwie unangenehm war, obwohl ich von meiner Mutter und anderen Verwandten mehrfach zu hören bekam: „Weil der liebe Gott dich besonders lieb hat, hat er dir diese Krankheit geschenkt!“ Total verwirrend – ich wusste nicht, was ich davon halten sollte, und meine Eltern wussten nicht, wie sie mir oder anderen die Situation erklären sollten. Mein Anderssein, meine Behinderung sollte ein Geschenk sein? Ich fühlte mich nicht beschenkt! Aber über ein Geschenk von Gott durfte niemand meckern, auch ich nicht. Ein Geschenk bekommt man nur zu besonderen Anlässen, dadurch wird man auf besondere Weise geehrt. Aber weshalb hatte ich dieses lästige Geschenk bekommen?
Im Haushalt hatte ich genauso meine Verpflichtungen wie meine jüngeren Schwestern. Es war mir auch wichtig, nicht behindert zu wirken. Ich wollte normal sein, dazugehören – und gehörte doch nicht wirklich dazu. Wenn ich gerade einen Krankenhausaufenthalt hinter mir hatte, machte es mir Mühe, mich wieder auf meine Familie einzustellen. Eine meiner Schwestern berichtete mir, dass unsere Mutter sie häufiger aufgefordert habe, meine Aufgaben zu übernehmen, weil ich doch „nicht so konnte“.
Читать дальше