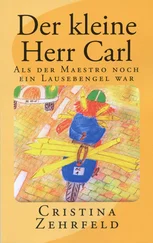Dann bekam ich völlig unerwartet Schmerzen an der Außenseite meiner linken Hand und wusste plötzlich, dass das von der Zeit im Krankenhaus herrührte. Immer wenn der Mann bei mir war, bewegte ich meinen Unterarm an den Gitterstäben meines Bettchens aus der liegenden Position nach oben und unten und schlug auf diese Weise an die einzelnen Gitterstäbe. Meine Hand erinnerte sich nun daran, und die damit verbundenen Erlebnisse standen wieder lebendig vor mir. Ich erinnerte mich auch an seine Stimme und die Aufforderungen. „Nun mach schon!“
Als kleines Mädchen hatte ich nicht gewusst, was ich tun sollte, was er von mir erwartete. Als erwachsene Frau von 33 Jahren begriff ich sofort, was dieser Mann von mir forderte. Jetzt wurde mir auch klar, warum ich im Alter von 20 Jahren beim Schmusen mit einem Freund mit heller Angst und Panik reagiert hatte, als er meine Hand in seinen Schoß gelegt und ich sein Glied gefühlt hatte. Ich hatte damals einen Vorwand gefunden, um die Beziehung sofort zu beenden. Ich hatte an meinem Verstand gezweifelt, weil ich mein Verhalten nicht begreifen konnte – schließlich war ich aufgeklärt und wusste „theoretisch“ Bescheid. Es war mir unerklärlich, warum ich plötzlich eine solche Angst, Panik, Abscheu und Verwirrung erlebt hatte.
Mit den Himbeerbonbons und den Goldnüssen kam die Erinnerung an die besonderen „Spiele“ wieder. Der Mann hatte mir sein erigiertes Glied durch die Gitterstäbe meines Bettes zum Spielen gegeben. Nachdem ich dieses „Spielzeug“ untersucht hatte und ich nicht viel damit anfangen konnte, war es für mich uninteressant. Die Aufforderung „Nun mach schon!“ bedeutete offensichtlich, dass ich das „Spielzeug“ wieder anfassen sollte. Er hatte währenddessen seine Hand zwischen meinen Beinen und versuchte meine Klitoris zu stimulieren. Die Art und Weise seiner Berührungen bereitete mir aber Schmerzen, und je erregter er war, umso gröber fielen seine Manipulationen aus.
Damals, 1950 bis 1962, vielleicht auch noch länger, gab es auch in diesem Krankenhaus feste Besuchszeiten; Sonntag und Mittwoch von 15.00 bis 17.00 Uhr. Auf diese Zeiten wurde peinlich genau geachtet. Die kleinen Kinder durften keinen persönlichen Besuch bekommen. Deshalb durften Verwandte nur durch die Scheibe in der Tür ihre Kinder anschauen. Offizielle Erklärung dafür: Die Gefahr sei zu groß, dass Besucher Infektionskrankheiten mitbringen. Außerdem, so hieß es, könnten die Kinder Heimweh bekommen und wieder anfangen zu weinen.
Wenn kleine Kinder merken, dass auf ihr Weinen, Schreien und Rufen nichts folgt – dass niemand kommt, niemand sie tröstet oder auf den Arm nimmt –, geben sie es auf. Sie lernen dabei, dass niemand für sie da ist. Die Hoffnungslosigkeit, die sich dann ausbreiten kann – bei René Spitz ( 3)als Hospitalismussyndrom beschrieben kann selbst ohne weitere Erkrankung schon zum Tod führen.
Ich musste alles in allem vier Monate in dem Fachkrankenhaus zubringen. Als ich entlassen wurde, hatte ich es nicht leicht, mich zu Hause bei meiner Familie wieder einzuleben. Meine Eltern waren ratlos, unter anderem auch, weil ich nicht „aufs Töpfchen“ konnte. Sie berichteten, ich sei völlig verändert gewesen noch mehr als nach dem ersten Krankenhausaufenthalt.
Ich erinnere mich, dass ich in der Zinkwanne mit warmem Wasser auf dem Topf saß. Die Maßnahme sollte bewirken, dass ich endlich wieder Stuhlgang bekam. Diese Erinnerung ist mit sehr mutlosen, traurigen Gefühlen verbunden. Verdauung war mir wirklich scheißegal. Äpfel durfte ich nicht essen, weil sie die Verstopfung noch hätten verschlimmern können.
Vier Monate! Nach so langer Zeit sind die bis dahin Vertrauten für ein Kleinkind „gestorben“. Der Boden ist ihm unter den Füßen weggerissen. Zum ersten Trauma, dem Aufenthalt auf der Isolierstation, waren weitere Traumata hinzugekommen.
Meine Neugier auf Unbekanntes war mit schmerzlichen Erfahrungen kuriert. Die Zeit der behüteten Kindheit mit emotionaler Sicherheit, Grundvertrauen und Unbeschwertheit war vorbei. Das Gefühl, alleingelassen, „verraten und verkauft“, Fremden ausgeliefert, nicht mehr geliebt und geschützt zu sein, war übermächtig.
Ich war kaum 14 Tage zu Hause, da wurden bei mir und meiner Schwester Theresia Scharlach ( 4)festgestellt. Also musste ich wieder ins Krankenhaus, dieses Mal mit meiner Schwester zusammen, für sechs Wochen.
Auch aus dieser Zeit habe ich noch einige Erinnerungen: Auf dem Arm einer Schwester zu sein und in einem Bett zu liegen, mit dem Kopfende des Bettes zum Fenster. Die gelbe Seife, nach der es im Krankenzimmer roch, habe ich später, als ich in einer Drogerie arbeitete, sofort wiedererkannt – es war „4711 Toska“. Auch andere Kinder waren in diesem Krankenzimmer, aber wir hatten keinen Kontakt zueinander. Meine Schwester habe ich dort nicht wahrgenommen. Jedes Kind lag in seinem Bett, an gemeinsames Spielen kann ich mich nicht erinnern.
Während meiner Psychoanalyse erinnerte mich an einen warmen Sommertag im Jahre 1951:
Ich bin wieder zu Hause. Das Fenster steht offen. Etwas unterhalb des Fensters ist das Dach der Waschküche. Von dort geht es einige Meter steil hinunter in den Garten. Ich weiß, ich brauche nur aus dem Fenster zu klettern, dann ist alles gut – dann ist alles zu Ende. Es ist nicht schwer, auf die Fensterbank zu kommen, ich schaffe das! Ich muss nur hochsteigen, mich ein bisschen hochziehen - und das mache ich auch. Ich sitze auf der Fensterbank, die Sonne scheint, und ich muss nur rausklettern!
Dem vorausgegangen war, dass ich plötzlich Schwierigkeiten bekam, an dem Fenster in der Praxis meines Analytikers – in der dritten Etage – vorbeizukommen. Ich war schon zigmal an diesem Fenster vorbeigegangen, aber nun befiel mich eine seltsame Panik. Mein Analytiker fragte, was denn mit dem Fenster sei, ob es schon mal ein besonderes Fenster gegeben habe. Ich erinnerte mich sofort an das Fenster im Schlafzimmer und berichtete davon. Er fragte mich, warum dieses Kind auf die Fensterbank krabbelt, wie es sich fühlt?
„Dann wäre endlich Schluss! Das muss gut sein! Dann ist es vorbei mit dem Töpfchen, dem Elektrisieren und allem, was ich nicht will. Dann habe ich Ruhe, dann tut mir niemand mehr weh! Warum klettere ich nicht raus? Es ist niemand da, der mich aufhalten könnte. Warum mache ich es nicht? – Heute noch nicht! Aber wenn es wieder zu schlimm ist, kann ich es tun. Heute scheint die Sonne!“
Ein dreijähriges Kind hätte sicher nicht so eine Antwort gegeben, aber als Erwachsene konnte ich die Gemütslage des kleinen Mädchens in Worte fassen.
Im Mai 1951 fotografierte mich mein Vater auf dem Balkon der Kinderstation. Einige Zeit später wurde ich nach Hause entlassen. Meine Mutter und eine Bekannte berichteten, dass ich auffällig verändert war. Mit der Zeit habe ich mich zuhause wohl eingelebt, aber die erste Zeit, also im Sommer 1951 war ich sehr mutlos. Im Sommer darauf ging es mir wahrscheinlich wieder besser. Und da bin ich sicher nicht mehr auf die Idee gekommen, auszusteigen.
Meine Eltern hatten einen Elektrisierapparat gekauft, damit sie mich nach der Behandlung im Krankenhaus weiter therapieren konnten. Diese Elektrotherapie sollte die Nerven im gelähmten Bein anregen, damit sie ihre Funktion wieder aufnehmen konnten. Die Lähmungen in meinem rechten Bein waren zurückgegangen. Das Bein war wieder stark. Wenn meine Eltern zu besonderen Anlässen Geld geschenkt bekamen oder etwas übrig hatten, brachten sie mich zur Krankengymnastin. Die arbeitete auch mit mir, aber oft musste ich lange warten, und bekann kalte Füße. Ich musste immer dann lange warten, wenn meine Mutter diese Zeit nutzte, um wichtige Besorgungen zu machen. Gleichzeitig hatte sie meine drei jüngeren Geschwister im Schlepptau, die sie auch noch zu beaufsichtigen hatte. Das für mich Schreckliche an der Krankengymnastik war, dass ich Dinge tun musste, die ich nicht gut oder gar nicht konnte, erst recht nicht, wenn ich kalte Füße hatte. Es machte mir keinen Spaß, aber ich musste dorthin und wusste nicht warum, es war nur lästig, langweilig und frustrierend.
Читать дальше