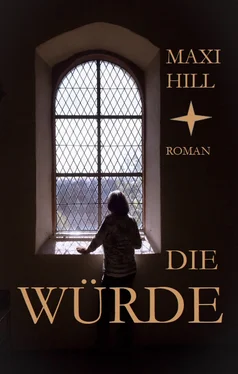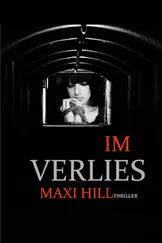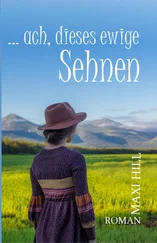1 ...6 7 8 10 11 12 ...15 Befreit lächelnd steigt er ein wenig später die Treppe wieder empor. Jemand knurrt ihm etwas entgegen, er hört es kaum. Die Musik dröhnt zu laut und zu dumpf aus dem Saal. Aus dem Gewirr der Leiber steigt stickiger Qualm und fuselgeschwängerter Dunst und nimmt ihm den Atem. Jetzt hört er es noch einmal knurren, ganz dicht bei ihm: »Alberner Kakadu«.
Er sieht diesen Kerl, der klein und unscheinbar den großen Mann markiert. Offenbar haben ihn jene vorgeschickt, die feixend an der Seite stehen. Er sollte seinen Mut beweisen und er hat wahrhaftig nicht versagt.
»Graues Maus«, blafft Amadou zurück und hebt seine Nase in die Luft. Gerade kann er der schnellen Faust noch ausweichen. Ein kleiner Tumult — einer der Ordner springt herbei — dann tritt wieder Ruhe ein.
Amadou ist längst bei seinen Gefährten angekommen, setzt sich auf seinen Platz und schaut gelangweilt in die Runde. Noch vor ein paar Minuten hat er vorgehabt, Eduardo zu überzeugen, mit ihm nach Hause zu gehen, ihre Musik zu hören und von angolanischen Weibern zu reden.
»Marlene, Marlene«, hatte er vor sich her gesummt. Das ist der Rhythmus, den er liebt, und »Kalimba, Kalimba«, das ist ein Text seines Volkes.
Einen Augenaufschlag lang, sieht er ein Gesicht in der Menge. Auf einmal reizt ihn der Gedanke an seine Musik nicht mehr. Er ärgert sich, das Gesicht wieder verloren zu haben. Er richtet sich kerzengerade auf. So groß, wie er ohnehin ist, wirkt seine Haltung sehr erhaben, sehr selbstgefällig. Aber muss man deshalb so giftige Redensarten führen, wie der Brigadier es tut? Amadou muss sich zwingen, nicht aufsässig zu wirken, doch klein zu machen gelingt ihm jetzt nicht mehr, zu kribbelig ist er plötzlich darauf, das helle Gesicht wiederzusehen, das, wäre es schwarz, seiner Schwester gehören könnte. Der Gedanke an dieses Gesicht treibt ihm das Blut in die Wangen, zum Glück nicht in die Lenden, wie es bei Esperanza wäre. Eine Unruhe erfasst ihn und dennoch will er den Platz nicht verlassen, diesen Platz, von dem er durch die Pflanzen im Raumteiler hindurch über die Köpfe der Sitzenden bis zur Tanzfläche blicken kann. Wenn der Tanz zu Ende ist, wird er wieder aufstehen, mannshoch wird er alles überblicken und dieses Gesicht finden, so wahr er Amadou «Rico» ist.
Das sind die Minuten, in denen sich Amadou im größten Tumult sonderbar allein fühlt. Sagen kann er das niemandem, sie würden es alle nicht verstehen, am wenigsten der Brigadier, der ihnen immer predigt, sie könnten doch froh sein, aus ihrer Scheiße in dieses Paradies gekommen zu sein.
Die Musik verklingt und Amadou springt auf, doch er kann das Gesicht nicht mehr sehen. Die Tanzpaare stieben in alle Richtungen davon, der größte Pulk bildet sich vor dem Ausgang, einige Unverwüstliche strömen zur Bar, andere zu den Toiletten. Zur Bar will er nicht gehen, dort ist man nicht gern gesehen. Von weitem leiden die Deutschen die Afrikaner, aber dicht zwischen ihnen spürt man die Distanz, die ihnen noch immer wichtiger ist, als die staatlich überachte Völkerverständigung.
Amadou kämpft sich durch, dem Ausgang entgegen, immer darauf bedacht, zu jedermann ein wenig Abstand zu halten. Für Sekunden sieht er ihn, diesen Kopf mit der hochgesteckten Frisur, mit den Kringeln… Ja, das muss sie sein. Amadou traut dem nicht, was er entdeckt — Oscare in der Nähe dieser Frau.
Zum Glück sieht er sie von fern, von Oscare unbemerkt. Sie reden miteinander und verschwinden in der Dunkelheit. Amadou bekommt keine Luft mehr. Was für ein Mordsrindvieh er doch ist. Doch er kann nicht anders, er folgt seiner Verrücktheit, seiner Flause, die ihn so fasziniert und die doch nur einem Sinn dienen soll, sein Heimweh zu heilen. Esperanza, seine einzige Geliebte, die er im Leben hatte, würde vor Entsetzen den Dreschflegel schwingen und ihm diese Eselei austreiben. Aber was weiß Esperanza von der Einsamkeit im Tumult des frostigen Lebens.
Ohne zu wissen warum, läuft Amadou in die Richtung, in die Oscare die Frau geführt hat, doch er sieht sie nicht mehr. Unschlüssig bleibt er stehen. Die Kälte des nahenden Winters kriecht unter die Jacke, seine Haut friert, sein Gemüt ist noch immer erregt. Mit heißem Herzen und fiebrigen Augen lauscht er in die Nacht. Was ist das für ein Tag, was ist das für eine Frau und was ist das für ein Kerl, dieser Oscare, der seine Freundin betrügt? Ein Freund war Oscare nie — ein Landsmann, mehr nicht.
Hinter der Friedhofsmauer hört Amadou ein Flüstern, kleine kitzelige Laute, unzüchtiges Röhren. Wieder bleibt er stehen, lauscht mit steifer Brust. Das Grunzen kennt er genau. Teufel, dieser Oscare! Irgendwie zwielichtig kam er ihm schon immer vor. Und rabiat. Keiner, mit dem man sich anlegen möchte. Es könnte schlimm ausgehen, würde Oscare erfahren, dass er belauscht wurde.
In der Nacht und wenn man ein gutes Gehör hat, bleibt einem das intime Leben anderer nicht verborgen. Was kann er dafür? Nur eines weiß Amadou nicht zu erklären. Oscare ist mit einer schwarzen Frau liiert, so wie Amadou mit Esperanza. Aber Oscares Frau ist hier, ist eine der drei Vertragsarbeiterinnen aus Angola. Die feiste Sudika führt ein starkes Regiment und Oscare ist in ihrer Gegenwart zahm wie ein Lamm. Sie würden nach ihrer Heimkehr heiraten, hatte er geprahlt. Warum entfernt er sich mit dieser Frau, mit seiner Nsamba . Wo ist Sudika? Dann fällt es ihm ein. Sudika arbeitet in der dritten Schicht, und die arbeitet heute Nacht.
Bisher glaubte er an das Gute im Menschen, besonders an das Gute seiner Landsleute. Das soll auch so bleiben. Oscare jedoch traut er seit dieser Stunde nicht mehr so viel Gutes zu, wie man Dreck unter den Nägeln hat.
Er lehnt an der Wand. Die Laute hinter der Mauer zwicken heftiger in seinen Ohren als die Kälte der Nacht. Amadou hat Mühe, die Hormone zu zügeln. Schübe heißer Regsamkeit wallen über die eben noch eiskalte Haut. Dennoch hört er zu, bis die Geräusche hinter der Mauer dumpfer werden. Aus den kitzeligen Stimmen formt sich ein Satz hart und direkt:
»Du gehst nicht mehr dort rein, verstanden?«
Stille.
»Hast du verstanden? Hau jetzt ab.«
Diese weibliche Stimme ist hart, ist unnachgiebig und herrisch. Nein. Er musste sich geirrt haben. Diese Stimme kann sich niemals aus der zarten Kehle dieser weißen Nsamba lösen. Niemals. Amadou schleicht um die Hecke herum. Oscare soll ihn hier ums Verrecken nicht sehen. Eine Gruppe deutscher Männer kommt die Straße entlang, grölt unbekannte Lieder. Amadou huscht in die Nebenpforte des Friedhofs und duckt sich hinter einen stinkenden Lebensbaum. Sie haben es nicht eilig, diese Deutschen. Jetzt, wo er ihren angeborenen Eifer gebrauchen könnte, jetzt nehmen sie sich sehr viel Zeit.
»Da war doch gerade noch dieser Bimbo. Wo ist der denn hin?«, krächzte einer.
»Jetzt kommen die schon in unsere Kneipen. Pass auf, das dauert nicht lange, dann wohnen die in unseren Häusern.«
»Solange sich keiner an meiner Frau vergreift …«, stottert ein anderer und stößt einen Stein mit dem Fuß gegen die Mauer, dass es scheppert.
»…oder dein Chef wird …«, hört Amadou Wortfetzen aus dem Mund eines dritten.
»So einer und Chef? Wer schwarz ist wie die Nacht, ist auch dumm wie die Nacht.«
Jemand tritt gegen das Eisentor und schreit: »He Bimbo, hat jemand die Käfigtür offen gelassen?«
Aus vereinten Kehlen dringt Gelächter, grell und niederträchtig. Amadou erstarrt vor Angst. Wenn sie ihn hier aufspüren, denken sie, er hat etwas verbrochen. Sie werden versuchen, es aus ihm heraus zu prügeln. Er bleibt in seinem Versteck hocken. Es stinkt nach Friedhof, nach fauligen Pflanzen und trockenem Grünzeug. Er mochte diese Art verlogener Bäume nie, wie diesen Taxus, der verlockend rote Früchte trägt, die einen Menschen ins Reich der Toten befördern können. Und er mochte auch die Thuja nicht, die die Leute hier Lebensbaum nennen, ihn aber trotzig dem Andenken ihrer Toten widmen.
Читать дальше