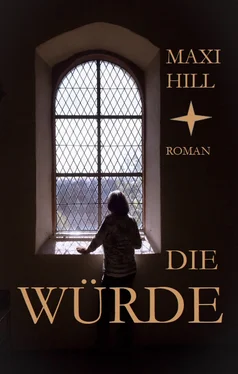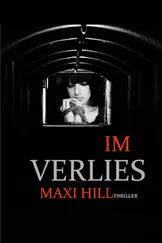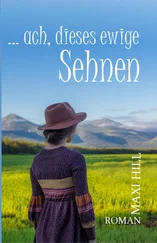Plötzlich ist eine knisternde Spannung im Raum — lange Blicke, angespannte, starre Muskeln. Worte, die ungesagt bleiben und jeden Ansatz von Vernunft blockieren.
»Sie muss ja nicht direkt bei uns wohnen. Vielleicht in unserer Nähe. In unserem Block. Es gibt viele kleine Wohnungen. Irgendwann wird schon eine frei werden.«
Piet schaut weg, schüttelt den Kopf und schweigt. Solche Gespräche haben nie gut geendet. Noch vor zwei, drei Jahren hätte es solche Gespräche nicht einmal gegeben. Noch vor zwei, drei Jahren hätte Toni klein beigegeben, weil sie den Schlagabtausch, der immer einsetzte, wenn sie nicht nachgab, als Verrat an ihrer Ehe verstanden hätte. In diesem Land ist sie klüger geworden, spät, aber nicht zu spät. Hier hat sie das Aufbäumen gelernt, nicht gegen ihren Mann, beileibe nicht. Aber hier hat ihr das Aufbäumen geholfen, nicht die Selbstachtung zu verlieren. Freilich hatte ihr Eigensinn ihn erschreckt. Ihren heimlichen Gängen in den bairro hatte er aus gutem Grund nicht zugestimmt. Jetzt aber sieht sie nichts, was sie verstehen könnte.
»Es geht mich nichts an, es ist deine Mutter. Für meine Mutter musste ich immer alleine entscheiden.«
Sie ist überzeugt, dass es so war, aber genau weiß man ja nie, wie der andere handeln würde, wenn man ihn zu handeln aufforderte.
»Warum sagst du so etwas?«
»Weil ich es so empfunden habe. Darum. Und weil die Zeit einmal kommt, wo man zurückgeben muss. Aus Dankbarkeit…«
Der Satz bleibt in der Luft hängen. Die beiden schweigen eine Weile - im Raum ist nur ihr Atem ist zu hören.
Sie kann sein Gesicht nicht sehen und es macht ihr Mühe, den Überblick zu behalten, wenn sie sein Gesicht nicht sieht.
»Was weißt du von meiner Dankbarkeit für meine Mutter!«
Das war keine Frage, das war nicht einmal Schelte. Sie spürt genau, wie er sich in fernen Erinnerungen verliert und irgendwann, nach endlosem Nachdenken sagt er plötzlich in die Stille des Raumes hinein:
»Was habe ich zeitlebens die erwartete Dankbarkeit gehasst.«
Vor ihren erschrockenen Augen beginnt er irgendjemanden nachzuäffen und hebt seine Stimme höher als gewöhnlich: »Wir tun mehr für Euch, als Kinder verlangen dürfen!« Und dann senkt er die Stimme tiefer als gewöhnlich. »Ob wir uns über etwas gefreut haben oder nicht, wir mussten ihnen immer danken und wir haben ihnen immer gedankt.«
Inzwischen weiß Toni nicht mehr, was sie ihm eigentlich übel nimmt, die Art wie er spricht, die Worte, die er wählt. Manchmal kennt sie ihn nicht, kennt sich selbst nicht.
Toni erhebt sich ein wenig zu rasch. Sie reißt die Tischdecke aus der Schublade und befördert sie schwungvoll auf den großen Esstisch in der Ecke des Zimmers. Mit stampfendem Schritt eilt sie in die Küche. Erst an der Tür lässt sie die kratzigen Worte heraus:
»Dankbarkeit ist etwas anderes als das Wort Dankeschön.«
Wie stets will sie ihm nicht zu nahe treten und wie stets, wenn sie freiwillig das Feld räumt, will sie nicht mehr über ein Thema sprechen. Es ist eine Art Schutz, ehe sie die Achtung verliert.
Er hatte keine Chance, etwas zu erwidern. Sie bleibt länger als nötig in der Küche und kommt mit dem dampfenden Essen und erstaunlich fröhlicher ins Zimmer zurück.
»Was sagst du nun? «
Es war ein Glück, dieses Fleisch erstanden zu haben, und dieses Glück gilt es zu sehen, nichts sonst.
Erst am Abend, als ihre Gemüter sich wieder beruhigt haben und die Kerzen ihnen jene Hilflosigkeit erhellen, in die man schuldlos geraten kann, erst dann finden ihre Gedanken noch einmal zurück zu dem Brief von John und dem, was die Zukunft noch bringen kann.
Es ist amüsant, wie Piet sich müht, seine ganze Güte nach außen zu kehren, sieht er einen Fehler ein. Zu sagen, »Liebling, du hast Recht«, käme ihm nie über die Lippen. Wenigstens hätte er doch sagen können, man müsse darüber sprechen oder man könne es Mutter Irma vorschlagen. Stattdessen sagt er: »John hat seinen Nutzen davon. Jeden Gang, jede Fahrt mit dem Auto bezahlt sie ihm. Ein schönes Taschengeld, und wer weiß, vielleicht …«
»Er ist doch weiß Gott nicht darauf angewiesen«, fällt sie ihm ins Wort.
»Du weiß, wie Erwin uns immer etwas aufgedrängt hat. Jetzt wird sie es tun, und er wird es nehmen, so wie wir es genommen haben.«
Selbstverständlich nimmt Piet ihre Worte als Kritik:
»Kennst du einen Menschen, der kein Geld braucht?«
Hat er von Geld gesprochen? Geld, Geld! Alle reden nur von Geld und nun auch Piet. Liegt es daran, weil sein Bruder John denkt, sie kämen als Schwerreiche aus dem Armenhaus der Welt zurück? Was glauben die nur alle? Wegen der paar Forumschecks wird man schief angesehen.
Das alles geht ihr so ungeordnet durch den Kopf, dass sie beinahe den Faden verliert.
Die Lampe flackert, der elektrische Strom ist wieder da und hält ihn davon ab, über ihre Einmischung empört zu sein. Noch während er kunstgerecht die Dochte der Kerzen aufrichtet, damit sie nicht im Wachs ertrinken, fressen ihre Worte an seiner Seele. Er weiß, auch Irma hält ihn für undankbar, nur weil er diesem Auftrag gefolgt war. Wer ist ihm denn für dieses Opfer dankbar und überhaupt: Steht die Dankbarkeit jedem auf der Stirn geschrieben? Niemand konnte schließlich wissen, dass es Vater Erwin dahinraffen sollte und Irma die Lebenslust verlieren würde. Es könnte ihr noch gut gehen, würde sie sich ein wenig mehr zusammennehmen. Wäre John nicht in ihrer Nähe, stellte sich die Frage anders, aber John ist da und er bemüht sich um Irma.
»Ich dachte immer, du magst Mutter nicht.« Das war keine Frage, das war kein Vorwurf, das war nichts als Rechtfertigung.
»Man muss nicht alle Welt mögen. Man muss nur wissen, was für den Moment wichtig ist. Hier war es Ntumba und zu Hause könnte es Mutter sein, die meine Hilfe braucht.«
Piet beugt das Gesicht unmerklich nach vorn, doch er schweigt.
»Kaum anzunehmen, das mit Irma könnte mich mehr Kraft kosten, als meine verbotenen Gänge in den bairro.«
Piets lauernder Blick huscht über den Brillenrand.
»Bedauerst du gerade, dass du Ntumba begegnet bist?«
»Nein. Ich habe von Anfang an gespürt, dass ich etwas anderes tun muss, als man von mir erwartet. Ich wusste nur lange nicht, was es hätte sein können.«
»Angola ist bald Geschichte, deine Familie aber behältst du für ewig.«
Toni zuckt unmerklich zusammen. Ja Geschichte, denkt sie, Geschichte ist unumkehrbar.
Das war ein solcher Moment, der ihr sagt, im Grunde sind sie sich immer einig, nur ihre Blickwinkel sind zuweilen verschieden. Bei ihm ist das Unrecht ein weißer Fleck im Schatten der Justitia, bei ihr ist das Unrecht der viel zu schwarze Schatten in den ausgemergelten, darbenden Gesichtern der Hoffnungslosen in den bairros auf der dunklen Seite der Welt, die man Sonnenseite nennt.
Der Gastraum in der Konsumgaststätte ist nett hergerichtet. Nur an den Tischen und an den schmalen Wänden leuchten kleine Lampen. Die schweren Vorhänge der ebenerdigen Fensterfronten sind geschlossen, Blicke von draußen wünscht man nicht.
Mit hündischer Ergebenheit folgen fünf schwarze Männer dem Brigadier, der sich groß tut, als habe er mit seiner Tischreservierung eine Heldentat vollbracht. Amadou, der freiwillig niemals dem Brigadier gefolgt wäre, weil er dem stets ein Dorn im Auge ist, liegt heute nichts mehr am Herzen, als von ihm in Ruhe gelassen zu werden.
Die gewaltige Schiebetür ist aufgeschoben und gibt den Blick frei in den hinteren, ebenso großen Gastraum, der mit Tischen und viel zu eng stehenden Stühlen vollgepfropft ist. Die Männer sind weiß Gott Enge gewöhnt, nur nicht diese Nähe zu den Deutschen.
Missgelaunt und ohne einen Blick mit dem Brigadier zu tauschen, sitzt Amadou da, dreht einen Bierdeckel zwischen den Fingern und findet das ganze Manöver plötzlich furchtbar albern. Hier würde er nicht tanzen und nicht reden — und trinken könnte man auch im Clubraum im Kombinat, wie man es schon immer gehalten hatte. Hier würde er diese Frau, diese weiße Nsamba , niemals finden und wenn, warum sollte die mit ihm reden, ihn, den der Schöpfungsregen in einen für sie minderwertigen Volksstamm gespült hat.
Читать дальше