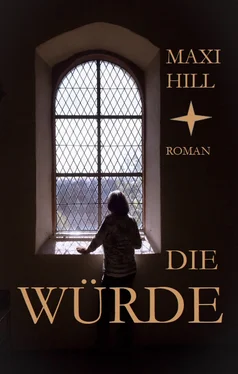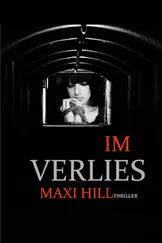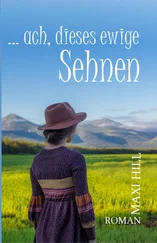Langsam, sehr langsam entfernt sich die johlende Meute. Amadou bleibt hockend wie ein scheues Tier. Es dauert lange, bis er den Mut findet, zurück zu gehen. Oscare würde er heute zum Glück nicht mehr in die Augen sehen müssen, und seine Nsamba wolle er nicht mehr zu Gesicht bekommen. Schade. Manchmal ist es besser, man bleibt unwissend.
Bedrückt von dieser heimlichen Erfahrung kehrt Amadou inwendig und äußerlich unterkühlt in das Lokal zurück. Spät ist es geworden. Der Tanz ist aus, die Männer von der Kapelle haben die Instrumente verpackt und sitzen schon an der Bar, um noch etwas zu trinken. Die meisten Plätze sind leer. Stühle und Tische stehen kreuz und quer. Aufbruchstimmung. Nur die Hartnäckigen trinken noch Bier, gönnen sich noch einen Absacker oder warten auf den Kassierer, um endlich aufbrechen zu können. Auch der Brigadier schwenkt seinen halbleeren Humpen in die Höhe und lallt, der Ober solle ihm noch einen vollen bringen. Es nutzt nichts, wenn Eduardo ihm behutsam auf die Schulter klopft.
»Es ist Feierabend, Chef!«
Der Brigadier stößt ihn rüde von sich. Heute macht er auf dicke Hose, er kann es sich leisten. Man hat schließlich geschuftet und wurde dafür ausgezeichnet. Gerade zögert Amadou, ob er diese Szenerie noch lange über sich ergehen lässt, als ihn ein Blitz trifft, unerwartet und stechender als jeder Gedanke zuvor. Ein Pärchen schreitet über die leere Tanzfläche, sehr eng und mit den Augen ineinander versunken. Sie ist es, die weiße Nsamba am Arm eines Uniformierten. Dieser Mann war vorher noch nicht hier gewesen, und diese Frau trägt das Haar offen. Also war sie es nicht, die von da draußen. Wer zum Teufel war das?
Ab jetzt hat es Amadou nicht mehr eilig. Er hat nur noch Augen für diese Nsamba und er schämt sich seiner widerlichen Gedanken. Jetzt erst recht muss er mit ihr sprechen, muss sie wie ein Bruder berühren, einmal wenigstens, vielleicht ergibt sich diese winzige Chance. Einen Moment lang träumt er davon, sie beschützen zu dürfen, wie er seine Schwester beschützt. Das gäbe ihm neuen Mut, neue Kraft für den Weg, der noch vor ihm liegt. So könne er sich todsicher wie ein richtiger Mann fühlen.
»Wo ist eigentlich Oscare?«, fragt er geistesabwesend ins Nichts. Noch immer kriegt er nicht zusammen, was er da draußen vermutet hat.
»Der schwirrt da irgendwo rum«, schreit der Brigadier in seinem Delirium, steht auf, um selbst nachzusehen und stürzt zu Boden. Der Stuhl fällt um, das Tischtuch rutscht mitsamt den Gläsern auf den Boden. Das Aufsehen ist perfekt. Alle starren auf die kleine Gruppe schwarzer Männer, die sich um einen weißen bemühen, den seine Füße nicht mehr tragen. Nur Amadou steht wie versteinert, hilft mit keiner Bewegung, das Durcheinander zu beseitigen. Er stiert auf den Raumteiler, der den Blick auf die Frau verhindert und auf den Mann in Uniform. Nur eines ist offensichtlich, die beiden begutachten das Malheur. Amadou macht sich lang, so lang er kann. Zwei Augenpaare treffen sich. Vor Freude entblößt er sein starkes, schneeweißes Gebiss, seine Augen flattern unruhig. Mit einem Satz ist er auf der anderen Seite der Pflanzen und steht vor ihr, groß, kräftig, aber artig wie ein Lamm:
»Du … du bist … Ich möchte reden … mit dir …Du aussehen wie meine Schwester.«
Die schöne, üppige Frau schaut ihn an, doch ihre Augen spazieren auf ihm herum, als ob er erst begutachtet werden müsse. Sie antwortet nicht, nur ein leises Zwinkern lässt ihn hoffen, dass sie ihn verstanden hat. Der Mann in Uniform zieht sie schimpfend mit sich fort. Im Gedröhn der Menge kann Amadou nicht alles verstehen, aber Worte wie die aus dem Busch und unsere Zivilisation hört er ganz sicher.
Nachdem Eduardo und Silva den Brigadier ins Schlepptau genommen haben, bleibt Amadou allein vor der Tür der Gaststätte im Schein der Laterne stehen. Er hat keine Angst, noch einmal der Stein des Anstoßes für deutsche Krakeeler zu werden, jetzt nicht mehr. Jetzt hat er sie gefunden, jetzt bleibt er am Ball. Es ist wunderbar. Und am schönsten ist, sie war es nicht, jene Biene, die Oscare um den Stempel schwirrte . Oder wie hatte es der Brigadier genannt?
Als die weiße Nsamba endlich den Saal verlässt und am Arm des Uniformierten an Amadou vorbei schreitet, flüstert sie, ohne stehen zu bleiben, mit samtiger Stimme:
»Heute nicht mehr, Süßer. Zu spät. Vielleicht morgen Abend im Eiscafé.«
Amadou schaut sie mit großen Augen an. Glücklich sieht sie nicht aus, eher müde, verbraucht, aber so schön wie Nsamba.
Auch wenn es aussieht, als führt der Uniformierte die Frau aufs Schafott, jauchzt alles in Amadou. Unter seiner Jacke schlägt ein Herz doppelte Töne. Zwar hat sie nicht gesagt, «komm morgen ins Café», zwar hat sie auch keine Zeit genannt, aber sie hat auch nicht gesagt, «hau ab», wie jene Frau es zu Oscare gesagt hatte.
Ach, Oscare. Amadou hüpft über die Straße. Er stößt einen Stein weit von sich und möchte am liebsten krakeelen, wie zuvor die Kerle am Friedhofstor. Er lässt es sein. Wippend schreitet er die Straße entlang der Baracke entgegen. Zu gerne würde er Oscare seinen Triumph spüren lassen, allein er traut sich nicht. Oscare ist ein störrisches Tier. Mama Mabele sagte immer: Wecke keine schlafenden Hunde!
Es ist ein grauer Morgen, gerade acht Uhr. Im kleinen Krankenhaus am Rande der Stadt macht sich Doktor Schäfer auf zur Visite. Zuvor hatte er mit der Stationsschwester den Plan für den Tag festgelegt: Wer wird entlassen, wer übernimmt die Nachtwache, wer arbeitet im OP. Dann bricht er auf — nicht wie in der vielgeliebten Fernsehserie mit einem Stab von weißgewandeten Mitarbeitern — er geht nur mit der Stationsschwester. Das genüge und mache den Patienten weniger Stress.
Doktor Schäfer kennt die Situation nur zu gut.
»Haben Sie mit der Patientin gesprochen?«, fragt er Schwester Marianne.
»Noch nicht. Ich dachte Sie wollen …«
»Natürlich, keine Frage«, sagt er schnell, wissend, das Thema Pflege ist bei den meisten Menschen schambesetzt.
»Es wird nicht leicht sein…«, pflichtet die Schwester ihm bei. Allerdings hat sie ihre Zweifel. Verständlich, schließlich haben die Alten ein schweres Leben bis hierhin gemeistert, ohne sich unterkriegen zu lassen.
»Ich glaube, sie will keine Hilfe. Sie tut so, als könnte sie noch die Welt einreißen.«
»Dann werden wir nicht den Buh-Mann spielen. Die Kommission hat schließlich geprüft und entschieden. Für die Klinik ist sie kein Fall mehr. Das Bett wird dringend für frisch Operierte gebraucht.«
Die Schwester muss nichts mehr erwidern. Im Falle Irma Hein weiß sie es besser als der Chef, wie rasch die Einigung erzielt wurde und das Gutachten vorlag, bevor die Gespräche mit dem Heim erfolgreich waren.
Auf dem engen Flur läuft John Hein auf und ab. Doktor Schäfer hat ihn gebeten, zur Visite zu erscheinen. Der Arzt weiß um den großen Vorteil, wenn der Patient direkt aus dem Krankenhaus in ein Heim kommt. Entlässt man nach Hause, könne sich das Procedere noch lange hinziehen. Schäfer begrüßt erst John Hein, dann greift er forsch zur Klinke.
»Guten Morgen«, sagt er gut vernehmlich und gibt der Schwester einen Wink, die Vorhänge aufzuziehen. In den Raum dringt die sonore Stimme: »Tageslicht ist das billigste Heilmittel, das wir haben, meine Damen.«
Am Bett gleich neben der Tür drückt er mit kühler Hand auf die Stelle über Irma Heins Handgelenk, wo er ihren Puls fühlen kann.
»Frau Hein, Ihr Blutdruck ist noch ein wenig hoch, aber sonst geht es Ihnen wieder prächtig.«
Das war eine Feststellung, der man nicht zu widersprechen versucht ist. Irma Hein hüstelt, ehe sie antwortet. Ihre Stimme klingt weder freudig noch erregt, sie zittert seit geraumer Zeit ein wenig.
Читать дальше