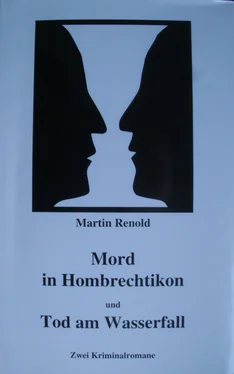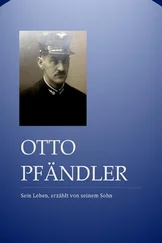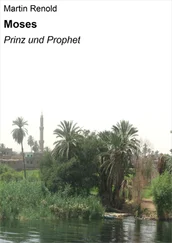Martin Renold
Mord in Hombrechtikon und Tod am Wasserfall
Zwei Kriminalromane
Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis
Titel Martin Renold Mord in Hombrechtikon und Tod am Wasserfall Zwei Kriminalromane Dieses ebook wurde erstellt bei
Mord in Hombrechtikon Martin Renold Mord in Hombrechtikon und Tod am Wasserfall Zwei Kriminalromane Dieses ebook wurde erstellt bei
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Tod am Wasserfall
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Impressum neobooks
Arthur Strahm, Detektivwachtmeister der Kantonspolizei Zürich, wohnte im Tiefenbrunnen. Vom Wohnzimmerbalkon seiner Wohnung aus überblickte er den unteren Teil des Zürichsees. Vereinzelt schossen Raketen in den Nachthimmel, von der billigen Sorte, solche, die nur in die Höhe zischen und oben einen Knall loslösen. Allmählich sah man auch die teureren, bei denen in mehr oder weniger raschem Fall eine einzelne farbige Lichtkugel niedersinkt und irgendwo zwischen Himmel und Erde verglüht. Weiter oben am Seeufer, bei Zollikon, wo die reichen Villenbesitzer Partys geben, sah man auch Raketen, bei denen farbige Kugeln in zehn, zwanzig oder hundert farbige Sterne auseinanderspritzen, aus denen weitere tausend herausgeschleudert werden wie beim Urknall, auch drüben, am anderen Ufer, in Wollishofen und Kilchberg. Weiter oben, wahrscheinlich in Rüschlikon, war ein ganz großes Feuerwerk im Gang.
Grund für diese Feuerwerkerei war der 1. August, der schweizerische Nationalfeiertag, kurz Bundesfeier genannt.
Wann hatte Strahm zum letzten Mal an einer Bundesfeier teilgenommen – mit Darbietungen der Turner, der Männer- und Frauenchöre, der Harmoniemusik, mit der Ansprache des Stadtpräsidenten oder gar eines Bundesrats!? Das war, als seine beiden Kinder noch klein gewesen waren. Jetzt waren beide erwachsen und verheiratet, der Bub und das Mädchen. Strahm wusste nicht einmal genau, ob es heute solche Bundesfeiern nach alter eidgenössischer Tradition überhaupt noch gab oder ob sich alles nur in dieser Knallerei und einer Ansprache des Bundespräsidenten am Fernsehen erschöpfte.
Früher, in seiner ledigen Zeit, da war noch mehr Romantik dabei gewesen. Nachts um das Feuer herum, von den roten Lampions der Kinder, den schönen runden mit dem Schweizer Kreuz, nicht den gelben mit Sonnen und Monden darauf, made in China. Und auf dem Heimweg durch den dunklen Wald, wenn die Lampions sich auf und ab bewegten und am Ausflackern waren, war es leicht gewesen, ein Mädchen, das hübscheste, das man sich im Schein des Feuers ausgesucht und beim allgemeinen Aufbruch nicht aus den Augen gelassen hatte, anzusprechen, ihm auf dem steinigen Weg den Arm anzubieten und, wenn es dann trotzdem unweigerlich stolperte, ihm den Arm um die Taille zu legen, damit es nicht noch einmal passiere. Das gab den Mädchen Sicherheit. Das waren noch Zeiten gewesen! Da musste die Polizei nicht ausrücken wegen unsittlicher Belästigung, nur weil man ein Mädchen angesprochen hatte.
Heute würden sich die Mädchen ja gar nicht mehr in der Nacht allein zu einem solchen Fest droben über dem Wald wagen. Als Polizist wusste er das zur Genüge. Heutzutage scheint ja niemand mehr sicher zu sein. Da lauern überall Gefahren: Raub, Vergewaltigung, Mord und Totschlag. Selbst Jugendliche rauben einander aus. Und wie war das vor ein paar Jahren, als er zu einem Mord gerufen wurde, als ein zwölfjähriges Mädchen vergewaltigt und erdrosselt wurde! Zu dritt waren sie gewesen. Zwei Mädchen hatten fliehen und die Polizei verständigen können.
Eines aber hatten alle Bundesfeiern gemeinsam, damals schon wie heute: die Knallerei, die Frösche und Schwärmer, die Kanonendonner und die Raketen.
Über dem Albis, bei Thalwil, zog ein Gewitter herauf. Schon ein paar Mal hatten Blitze gezuckt. Man wusste eigentlich nicht recht, war es Feuerwerk von jenseits der Albiskette, oder war es wirklich ein herannahendes Gewitter. Jetzt aber hörte man auch den Donner. Das Gewitter schien in Richtung Zürcher Oberland zu ziehen. Ein Ausläufer kam auch über den Uetliberg. Als die ersten Tropfen auf den Balkon spritzten, ging Strahm ins Wohnzimmer. Aber er ließ die Balkontür offen. Er liebte den würzigen, frischen Duft von der Erde, vom Garten vor dem Haus. Und schiere Begeisterung konnte ihn erfassen, wenn ein nächtliches Gewitter so nahe kam, dass seine Blitze die Stube – er drehte dann immer das Licht aus oder zog im Schlafzimmer die Vorhänge zurück – taghell erleuchtete und der Donner unmittelbar darauf krachte, so dass Gertrud, seine Frau, die Ohren zuhielt oder sich unter der Decke versteckte. Das war etwas anderes, etwas Gewaltigeres als diese blöde Feuerwerksknallerei.
Es regnete nicht lange. Das eine Gewitter war im Norden vorbeigezogen, das andere im Süden. Aber die Blitze zuckten immer noch, und der Donner widerhallte ununterbrochen.
Gertrud Strahm saß in einer Ecke des Wohnzimmers und las in einem Buch. Turi, so nannte ihn seine Frau, hatte die Zeitung auf dem Tisch ausgebreitet, aber er hatte keine Lust mehr zum Lesen. Es war schon spät.
„Ich lese nur noch zwei Seiten“, sagte die Frau, dann ist das Kapitel zu Ende. Geh doch schon zu Bett. Ich komme gleich nach.
Als Strahm sich gerade erhob, schrillte das Telefon.
„Was ist los?“, fragte die Frau, als er den Hörer auflegte.
„Ich muss noch weg. Walser hat angerufen. Ein Mord in Hombrechtikon. Der Schriftsteller Federbein.“
„Was, Michael Federbein!?, rief Gertrud und hielt sich die Hand vor den Mund, als ob sie die Frage zurückhalten wollte. „Das ist doch unmöglich.“
„Doch. Hast du schon etwas von ihm gelesen=“
„Ja, seinen letzten Roman.“
„Walser wird mich gleich abholen. Wir fahren zusammen in seinem Wagen.“
Strahm zog Schuhe und Kittel an.
Keine zehn Minuten später klingelte es.
Strahm, der schon ungeduldig im Zimmer hin und her gegangen war, griff hastig nach dem alten Schlapphut auf dem Garderobenbrett, ohne den er nie ausging, drückte ihn tief in die Stirn und riss die Tür auf.
„Pass auf!“, mahnte Gertrud und schloss hinter dem Hinauseilenden die Tür ab.
Walser steuerte in Richtung Zollikerberg auf die Höhenstraße zu. Die Straßen waren schon beinahe wieder trocken. Als sie auf die Forch kamen, sahen sie, dass sich das Gewitter gegen das Oberland verzogen hatte. Über dem Hörnli und gegen das Toggenburg und den Säntis wetterleuchtete es noch. Im Westen über dem Zürichsee hatten sich die Wolken schon geteilt, und der aufgerissene Himmel verhieß für morgen wieder einen schönen, heißen Sommertag.
Als sie bei der Kirche von Hombrechtikon vorbeifuhren, schlag es gerade zwölf.
„Weißt du, wo es ist?“ fragte Strahm.
„Ja, auf der andren Seite des Dorfes, im Laufenbach“, antwortete Strahms Kollege. „Nach der großen Kurve Richtung Wolfhausen… Jetzt, da vorne, müssen wir rechts abbiegen.“
„Erst im letzten Moment, bei der großen Scheune, sahen sie die kleine Tafel mit der Aufschrift „Laufenbachstraße“ und die Abzweigung.
Das Haus des ermordeten Schriftstellers war nun leicht zu finden. Es war bereits von der Polizei umstellt.
Strahm kannte den Schriftsteller Michael Federbein nur von Bildern in Zeitungen und Illustrierten und aus dem Fernsehen. Gelesen hatte er noch keines seiner Werke. „Das unschuldige Haus“, ein Stück von ihm, hatte er vor zwei oder drei Jahren einmal im Schauspielhaus gesehen, zusammen mit seiner Frau. Er erinnerte sich nur noch an den Titel.
Читать дальше