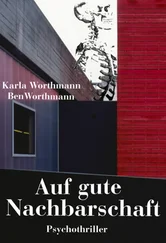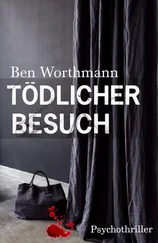Das also war der ganze komplexe Hintergrund, angesichts dessen es Anna an jenem schönen Maiabend für tadelnswert hielt, abfällige Bemerkungen im Freien zu machen. Plötzlich musste ich niesen, und zwar nicht nur einmal. Meine Augen begannen zu tränen, und ich suchte nach einem Taschentuch, natürlich vergebens, denn ich hatte nur eine Badehose an, worüber Anna und die sogenannten Kinder – Max, unser Ältester, und Julius, der Jüngste, wohnten immer noch bei uns, nur Paul war kürzlich ausgezogen -, sich bereits mokiert hatten. Sie nahmen es als Indiz für alarmierend wachsende altersbedingte Eitelkeit.
Max, der gerade sein Studium an der Hochschule der Künste abgeschlossen hatte und noch ein bisschen Zeit zur Selbstfindung benötigte, wie er uns wissen ließ, fand Körperbräune schon aus Prinzip spießig. Er legte Wert auf seine Blässe, zumal er sich gerade von seiner Freundin getrennt hatte, was ihm Gelegenheit bot, eine kleine Depression zu pflegen. Um die optische Präsentation dieses Zustandes perfekt zu machen, hatte er auch Abschied von seinem kreativen Pferdeschwanz genommen und trug das Haar neuerdings stoppelkurz. Julius leistete seinen Zivildienst ab, was der Selbstfindungsphase, in der sich auch er befand, insofern eine zusätzliche Dynamik verlieh, als er Fragen nach dem Sinn des Lebens zu stellen begann. Er arbeitete in einem Spastiker-Kleinheim, wobei „klein“ lediglich die die baulichen Dimensionen der Einrichtung beschrieb, nicht aber die Last, die ihm hier täglich auf seine neunzehnjährigen Schultern geladen wurde. Julius musste Schwerstbehinderte füttern, waschen, wickeln und ins Bett bringen, einige davon kaum älter als er selbst und infolge von Unfällen querschnittgelähmt. Das alles setzte ihm zu, und zuweilen überkam mich, ehrlich gesagt, leise Scham, wenn ich über meinen Job stöhnte. Wenn Anna und ich ihn dazu zu animieren versuchten, in seiner Freizeit an die frische Luft zu gehen, wurde er jedes Mal ungehalten. „Wie wär's, wenn ihr es einfach mir selbst überließet, wie und wo ich meine Freizeit verbringe?“, lautete seine Entgegnung.
Er war noch blasser, länger und schmaler als Max, und in den Blicken, mit denen er seinen sich bräunenden, um seine körperliche Fitness besorgten Vater gelegentlich bedachte, lag unübersehbar ein Anflug von Arroganz. Er hatte so etwas nicht nötig. Er stöberte in meinen Bücherregalen, spielte ein bisschen auf seiner Gitarre, saß am Computer und nutzte die Nächte, soweit es sein Dienstplan erlaubte, zu ausgedehnten Kneipentouren mit seinen ehemaligen Klassenkameraden, Letzteres mit besonderem Engagement.
Immer noch niesend erhob ich mich aus meinem Liegestuhl und ging ins Haus, um mir einer Packung Papiertaschentücher zu holen. Anna folgte mir. „Wirst du krank?“, fragte sie in diesem hoffnungsvoll-besorgten Ton, den wir beide nur zu gut kannten. Anna hatte mich gern zu Hause, ganz im Gegensatz zu jenem traurigen Klischee der Langzeitehefrau, welcher davor graust, dass der Gatte einmal krank, arbeitslos oder pensioniert werden könnte.
Marga Zarkowski, eine ältere Frau aus unserer Straße, mit der Anna trotz des Generations- und, nun ja, auch Milieuunterschieds auf vertrautem Fuß stand, war solch ein Fall. Sobald Emil, ihr Mann, des Abends von der Arbeit heimkehrte, wurde sie nahezu hysterisch. Er musste seine Kleidung weitgehend auf der Terrasse ablegen und erst duschen, bevor er den Wohnbereich betreten durfte. Das Essen wurde ihm in der Küche verabreicht, und während er es zu sich nahm, verließ Marga demonstrativ den Raum. Emil Zarkowskis Schlafstelle befand sich im früheren Gästezimmer unter dem Dach. Er führte das Leben eines gerade eben geduldeten Schlafburschen, wie man früher gesagt hätte, und das in seinem eigenen Haus, das er übrigens vom Keller bis zum Dach tadellos, wenn auch ziemlich geschmacklos renoviert hatte. Emil war Maurer und außerdem Experte für die meisten anderen Tätigkeiten, die beim Hausbau anfallen, es gab kaum ein Haus in unserer Gegend, in dem er nicht schon einmal Hand angelegt hatte. Das heißt, eigentlich gehörte sein Handwerkerleben längst der Vergangenheit an, denn inzwischen war er an die siebzig und in Rente. Doch er ging weiterhin Tag für Tag seinem Beruf nach – soweit man von Beruf reden kann, wenn jemand gut bezahlte Arbeiten verrichtet, ohne dass das Finanzamt etwas davon erfährt. Dabei beruhte Emil Zarkowskis ungebrochener Schaffensdrang keineswegs auf Geldgier, jedenfalls nicht ausschließlich, obschon seine Augen leuchteten, wenn er die Bündel von Scheinen aus seinen speckigen Drillichhosen fingerte. Die wahre Triebfeder war Marga. So wenig sie seine Anwesenheit ertrug, so sehr war er bemüht, ihr diese zu ersparen. In gewisser Weise passten die Zarkowskis also sehr gut zusammen – ein fast perfektes Paar. Dass es auch Eheleute wie Anna und mich gab, die einander nicht aus dem Wege gingen, wollte ihnen kaum in den Kopf. Sie konnten so etwas nicht verstehen.
Anna wiederholte ihre Frage, ob ich dabei sei, krank zu werden, eine kleine Sommer-, genauer, Frühlingsgrippe vielleicht. Ich rechnete kurz nach, wann ich zuletzt krank gewesen war. Sechs Wochen lag diese Zahngeschichte zurück, als man mir den halben Oberkiefer aufgeschnitten hatte. Einerseits reizte mich die Aussicht auf ein paar freie Tage, andererseits war mir bei dem Gedanken nicht ganz wohl. Ohnehin war ich einer der Ältesten in der Redaktion, und die Aussicht, über kurz oder lang nicht nur als alt – wenn auch einigermaßen gut erhalten – zu gelten, sondern auch mit dem zweifelhaften Image eines Kollegen behaftet zu sein, der zwar „erfahren und routiniert“, jedoch gesundheitlich nicht mehr voll auf der Höhe ist, gefiel mir dann doch nicht so besonders. Außerdem fehlten gerade ein paar Leute wegen Urlaubs oder Dienstreisen.
„Was geht dich das an?“, gab Anna zu bedenken. „Mein Gott, du hast da doch sowieso nichts mehr zu gewinnen – und zu verlieren auch nicht.“
Das entsprach im Prinzip voll und ganz meiner eigenen Sicht der Dinge. Und dennoch zögerte ich, auch deswegen, weil ich für die übernächste Woche bereits den ersten Teil meines Jahresurlaubs angemeldet hatte.
„Du brauchst doch nur den Reinhold anzurufen“, drängte Anna. Auch damit lag sie richtig. Reinhold würde mir den gelben Schein einfach in den Briefkasten werfen. Er wohnte ein paar Straßen weiter, das war für ihn gar kein Problem. Reinhold war außerdem mein Freund, abgesehen davon, dass er mein Hausarzt war. Wir trafen uns hin und wieder „auf ein Bier“, wie er es nannte, obschon ich mich nicht erinnern konnte, dass bei diesen Zusammenkünften jemals Bier getrunken worden wäre. Doch in letzter Zeit ging mir Reinhold ein bisschen auf die Nerven. Mir stand nicht der Sinn nach seiner Gegenwart. Überdies hatte ich in den nächsten Tagen sowieso einen Termin bei ihm wegen der wieder mal fälligen Routineuntersuchung.
Später am Abend, als Anna schon zu Bett gegangen war und ich mit meinem Rotwein in meinem Sessel saß, hing ich meinen Gedanken nach. Früher waren die Männer etwa in meinem derzeitigen Alter oder sogar noch jünger gestorben. Der moderne, oder besser postmoderne, wenn nicht sogar schon postpostmoderne Berufstätige lebte zwar länger, musste aber auch mehr Lebenszeit mit Arbeit vergeuden, um die materiellen Voraussetzungen dafür zu erwirtschaften, dass er länger auf diesem Planeten weilen durfte. Man arbeitete länger, um länger ein Leben führen zu können, das einem durch die Arbeit ruiniert wurde – das war die wenig erfreuliche Regel dieses Spiels.
Ich schlief nicht besonders gut, und am nächsten Morgen erwachte ich, bevor der Wecker seine Chance hatte. Ich wankte in die Küche, öffnete den Wandschrank und schluckte meine Pillen – Vitamine, Mineralstoffe, Johanniskraut – und nahm dann auch noch ein Aspirin wegen des leichten Rotweinkaters. Dann steckte ich kurz den Kopf zum preußisch-gelben Wohnzimmer hinein, wo Anna, wie immer, schon auf der Couch saß und Zeitung las, den Hund zu ihren Füßen. Sie fragte, wie es mir gehe, und ich sagte, es sei schon okay, es sei doch kein Schnupfen geworden.
Читать дальше