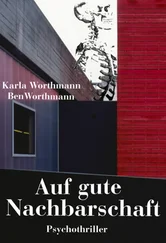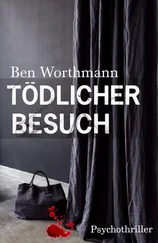Das Ergebnis bestand letztlich darin, dass sie nun in meiner Person einen „erfahrenen und routinierten Mitarbeiter“ besaßen, der objektiv betrachtet deutlich überbezahlt war und im Grunde auf seinen Job und überhaupt diesen ganzen Laden pfiff. Das geschah ihnen nur recht, wie ich fand.
Doch leider blieb meine Schadenfreude nicht ungetrübt, denn das Ärgerliche war: Ich fühlte mich zunehmend wie ein Sträfling, auch wenn das ein wenig frivol anmuten mochte angesichts des Schicksals vieler Mitbürger, die gar keine Arbeit hatten oder mit wesentlich kleineren Einkommen abgespeist wurden. Vielleicht hätte ich einfach den Mund aufmachen und vorschlagen sollen: „Bitte sanieren Sie mich weg. Zahlen Sie mir ein paar Jahresgehälter und die Sache ist für mich erledigt. Und für Sie bin ich so perspektivisch erheblich kostengünstiger.“
Aber dazu fehlte mir dann doch der Mut. Es ist schon ziemlich schwierig, sich als abhängig Beschäftigter auf Dauer seine Authentizität zu bewahren, um einmal diese arg strapazierte Vokabel zu benutzen. Manchmal, wenn der Feierabend nahte, fühlte ich mich dermaßen unauthentisch, dass ich versucht war, einen Strich an die Wand meines Büros zu kratze, und selbst am Abend zu Hause überkamen mich beim Blick auf die Wände der beiden Wohnräume – Putz, mit biologisch unbedenklicher Farbe gerollt, in dem einen weiß, im anderen preußisch-gelb – zuweilen gewisse Anwandlungen, solch einen Häftlingskalender für mein dahinschleichendes Daseins anzulegen.
Ich sah die Strichpäckchen deutlich vor meinem geistigen Auge, an der Wand über dem Klavier, neben dem Selbstportrait meines Vaters, allerdings gesellte sich dann sogleich auch das Bild von Anna hinzu, die mein Treiben mit Anzeichen äußerster Missbilligung verfolgen würde. Mich mit einem Nagel oder Schraubenzieher Strichlisten an die Wand kratzen zu sehen, hätte sie zweifellos noch weniger akzeptiert, als wenn ich Rotweinflecken auf den weißen Polstern hinterlassen hätte.
Dabei hätte sie durchaus ein gewisses Verständnis für meine Motive aufgebracht. Sie hasste meinen Job mindestens ebenso sehr wie ich. Und sie hatte sich inzwischen mit dem Gedanken vertraut gemacht, dass es so etwas wie männliche Wechseljahre gibt. In guten Phasen nahm sie es mit Humor. Schließlich erlebte sie an sich selbst die ersten Anzeichen dessen, was hier gespielt wurde, auch wenn das ihrer Jugendlichkeit einstweilen nicht den geringsten Abbruch tat. Es schien mir immer wieder unbegreiflich, dass sie nur wenige Jahre jünger war als ich und auf die fünfzig zuging. Dabei war längst klar, dass sie von uns beiden die besseren Gene hatte. Man musste sich nur meine Schwiegermutter ansehen, die weit über achtzig war und dabei munter wie eine Sechzigjährige. Verkäufer von Anti-Aging-Produkten würden jedenfalls bei Anna nie ein offenes Ohr finden, und wenn wir zwanzig Jahre weiter wären, würde unweigerlich der Tag kommen, da man sie für meine Tochter halten würde. „Was will so ein alter Kerl mit solch einem jungen Ding?“, würden die Leute sagen.
Wenn ich mich in dieser Weise Anna gegenüber äußerte, reagierte sie natürlich geschmeichelt und meinte, ich solle mal bloß nicht übertreiben – zumindest in den guten Phasen. In den weniger guten kam es jedoch auch vor, dass wir beide mit dem Schicksal zu hadern begannen. Anna verfluchte bestimmte Hitzewallungen und ich erzählte ihr etwas vom Burnout-Syndrom und von meinen melancholischen Anwandlungen, nicht zu vergessen die länger werdenden Regenerationszeiten nach dem Sport. Gelegentlich gerieten wir hierüber einander in die Haare. Anna fragte mich, weshalb ich es nicht wie andere machte und stattdessen nach wie vor meine Tage im Büro zubrachte.
„Andere“, das waren zum Beispiel die dicken Knoops, unsere Nachbarn. Er hatte sich vorletztes Jahr, mit knapp fünfzig, frühpensionieren lassen, wegen eines angeblichen Meniskusschadens, der ihn daran hinderte, vom Parkplatz der Import-Export-Firma, bei der beschäftigt war, sein vierzig Meter entferntes Büro zu Fuß ohne Gehhilfe zu erreichen. Woran ihn der Meniskusschaden eindeutig nicht hinderte, war freilich, sich um den Garten zu kümmern, die Bäume zu beschneiden und den Rasen zu mähen sowie ausgedehnte Einkaufsgänge zu unternehmen. Der gelbe Krückstock, den er meistens mit sich führte, wenn er das Haus verließ, war in unseren Augen der glatte Hohn. Frau Knoop arbeitete im öffentlichen Dienst – soweit das Wort „arbeiten“ hier wirklich passt -, was praktisch bedeutete, dass sie nur ein wirkliches Problem hatte: in jenen Zeiten, da sie gerade einmal nicht krankgeschrieben war, irgendwie ihren Jahresurlaub unterzubringen.
Die Knoops hatten einen Adoptivsohn von zwölf oder dreizehn Jahren, Stefan hieß er dem Vernehmen nach, den sie in einem Internat untergebracht hatten. „Diese Doppelbelastung, das ist einfach zu viel für meine Frau“, hatte Herr Knoop gegenüber Anna als Erklärung hierfür angeführt. Während der Ferien wurde das Kind bei Bekannten in Süddeutschland einquartiert, sodass sich die Zeiten seines Aufenthalts im Haus seiner sogenannten Eltern auf ein äußerstes Minimum beschränkten, was aber vermutlich für alle Beteiligten die beste Lösung war und einzig die Frage offenließ, weshalb die Knoops den Jungen überhaupt adoptiert hatten.
Im Sommer bekamen wir notgedrungen mit, wie die beiden jeden Tag gegen Abend auf der Terrasse saßen, üppige Mahlzeiten mit hohem Fleischanteil einnahmen und dazu Sekt und Weißbier in sich hinein schütteten, um sich sodann verklärten Blicken und schon etwas unsicherem Gang im Schein der Abendsonne am Gedeihen ihrer Sträucher, Blumen und Gräser sowie der Frösche im Gartenteich zu delektieren. Das sah in der Tat nach schweren Belastungen aus, ein Kind hätte da nur gestört, zumal die Knoops auch noch eine Katze besaßen. Die war gleichfalls übergewichtig, und wenn sie gelegentlich bei uns herumlungerte, hatte sie Mühe, zurück über den Zaun zu flüchten, sobald Frieda die Szene betrat. Den Gartenteich hatte Herr Knoop übrigens im Jahr zuvor höchstpersönlich in wochenlanger Arbeit angelegt, auch das trotz seines angeblichen Knieschadens. Was das Verhältnis von Frieda zu den Knoops ansonsten anbelangte, so war es, anders als das zur Katze der beiden, außerordentlich freundschaftlich. Der Grund dafür waren die Reste der allabendlichen Mahlzeiten, die regelmäßig über den Zaun flogen.
Frieda hatte diesen Vorgang offenkundig fest in ihren sommerlichen Tageslauf eingeplant. Solange sich die Nachbarn auf ihrer Terrasse der Völlerei hingaben, weigerte sie sich jedenfalls strikt, um den sogenannten Block zu gehen. Erst wenn sie anschließend die Knochen teils gefressen, teils in einem ihrer Vorratslager verstaut hatte, die sich meines Wissens hinter dem Komposthaufen und im Rosenbeet befanden, ließ sie wieder mit sich reden. Ob sie noch über weitere Vorratslager verfügte, die ihren wölfischen Ursprung dokumentierten, entzog sich meiner Kenntnis. Sie tat damit immer sehr geheimnisvoll. Das Rosenbeet sah aber eindeutig nicht so aus wie die Beete in den Nachbargärten. Es wirkte ein wenig so, als hätte jemand versucht, dort Aushübe vorzunehmen, vielleicht zu dem Zweck, nach verborgenen Schätzen zu suchen oder Grabstätten für Kleintiere anzulegen. Unser Rosenbeet war eine einzige Katastrophe, um es mal ganz klar zu sagen. Und Frieda legte infolge der Zusatzernährung vom Tisch der Knoops derart an Gewicht zu, dass sich der Tierarzt beim letzten Impftermin zu der Bemerkung veranlasst gesehen hatte, der Hund sei für seine Größe entschieden zu schwer. Ich entgegnete ihm, da müsse er erst einmal die Leute sehen, die wesentlich zu dieser Entwicklung beitrügen, was der Veterinärmediziner mit leicht irritiertem Blick quittierte.
In der Tat handelte es sich bei Frieda keineswegs um ein besonders eindrucksvolles Exemplar ihrer Gattung, soweit es die Größe betraf, alles in allem lag der Mann vermutlich nicht völlig falsch. Den Papieren zufolge war Frieda eine „Mischung auf Cocker-Basis“, ohne dass sich einem auf Anhieb der tiefere Sinn respektive Realitätsgehalt dieser Klassifizierung erschlossen hätte. Frieda war klein, schwarz, irgendwie kompakt und im übrigen einfach nur extrem verfressen. Aber von einem Cocker hatte sie nun ganz gewiss gar nichts. Mir kam sie eher wie eine Mischung aus Spitzen, Dobermännern, Terriern und anderen Hunderassen vor, die sich in erster Linie durch Dreistigkeit und Großmäuligkeit, gepaart mit Opportunismus, auszeichnen.
Читать дальше