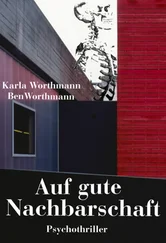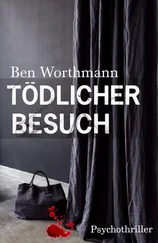Ben Worthmann
Etwas ist immer
Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis
Titel Ben Worthmann Etwas ist immer Dieses ebook wurde erstellt bei
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Mehr über den Autor
Impressum neobooks
In dem Jahr, in dem mein Großvater starb, starben auch seine Schwester und der vorletzte seiner Brüder, und der Bau unseres Hauses kam so weit voran, dass man sehen konnte, dass es ein Haus werden sollte. Man könnte auch sagen, es wurde viel geschippt und geschaufelt – einerseits, um Aufbewahrungsstätten für Tote, andererseits, um eine Wohnstatt für Lebende anzulegen.
Während die einen in hölzerne Kisten verfrachtet und in jene Erde, von der man sie verabschiedete, eingegraben wurden, sahen die andere aus eben dieser Erde ein steinernes Gebäude entwachsen, das ihnen Hort und Heimat werden sollte. Im Zeitalter der Hypertechnisierung mutet es mitunter seltsam an, welch hergebrachte, um nicht zu sagen altertümliche Methoden der vermeintlich zivilisierte Mensch immer noch anwendet, wenn es darum geht, Unterkünfte für seinesgleichen zu schaffen. Abgesehen von ein paar Details hat sich daran im Lauf der Jahrhunderte nur wenig geändert.
Der Mensch hat offenkundig das Bedürfnis, sich in Hohlräume zurückzuziehen. Er kann es nicht verwinden, dass er aus dem Mutterleib ausquartiert worden ist. Daher macht er sich am Leib der Mutter Erde zu schaffen und übersät ihn mit Millionen von mehr oder minder geräumigen Gruben, nur um sie anschließend wieder mit etwas zu füllen, von dem er meint, dass es unter die Erde gehört. In die eine Art von Löchern legt er jene Artgenossen, die alles Irdische hinter sich gelassen haben, in die anderen Erdlöcher setzt er steinerne Behausungen für diejenigen, die noch ein Leben voller Verheißungen vor sich zu haben glauben, was sich oft genug als Irrtum erweist.
Das moderne Wohnhaus ist im Grunde das Nachfolgemodell sowohl der prähistorischen als auch der ägyptischen Pyramide, es ist ein künstlicher Uterus-Ersatz, eine Gruft für die Lebenden und zugleich das Luftschloss eines melancholischen Triumphs, mit welchem sich die Illusionen des Lebens ein eigenes Denkmal zu setzen versuchen. Denn genau genommen handelt es sich doch nur um eine Art oberirdische Zwischenlagerstätte, von der aus es dann eines Tages gleichfalls in die unterirdische Richtung gehen wird, dorthin, wo das Individuum den Zustand seiner äußersten Unbehelligtheit erlangt – strikte Einzelunterbringung in Furnier, kein Telefon, nicht mal ein Fenster, und obendrauf zwei Meter Mutterboden, als Dämmstoff, wirkungsvoller als jede Schallisolierung. Dort unten ist man absolut sicher und ungestört.
Wer den Entschluss fasst zu bauen, hat allerdings zunächst anderes im Kopf, als sich mit den spezifischen Eigenarten der Ewigkeit auseinanderzusetzen, auch wenn er sich einbildet, etwas sehr Definitives zu tun, zumindest hierzulande. Die Deutschen bauen ihre Wohnhäuser ja bekanntlich so, wie einst die mittelalterlichen Bischöfe ihre Dome: Als seien sie dazu bestimmt, bis ans Ende aller Tage zu stehen. Mit den ethischen Fragen der Beendigung des menschlichen Erdenlebens indes beschäftigt sich der normale Bauherr höchstens insofern, als er über kurz oder lang Mordgedanken gegen den Architekten und gewisse Handwerker hegen wird.
Hätte ich alle diesbezüglichen Anwandlungen im Verlauf jenes Lebensabschnitts, den wir später kurz die „Bauphase“ nannten, wirklich in die Tat umgesetzt, so wäre ich zweifellos als einer der produktivsten Serienkiller in die Geschichte des deutschen Kapitaldelikts eingegangen und wäre meiner Freiheit verlustig gegangen. Nun ja, sagen wir lieber, meiner relativen Freiheit, denn ich bin verheiratet und im Angestelltenverhältnis beschäftigt.
Wie dem auch sei, es liegt mir gar nicht so besonders, den Dingen allzu viel Bedeutung beizumessen und ständig wie mit einem weltphilosophisch geeichten Geigerzähler herumzulaufen. Ich habe zwar einen leichten Drang zur Überhöhung des Banalen und stelle mitunter gerne meine Betrachtungen über den Gang der Dinge und den Sinn des großen Ganzen an, sofern sich dazu eine Gelegenheit bietet, aber mehr auch nicht. Anna, meine Frau, billigt allerdings selbst diese dezent entwickelte Neigung nur in begrenztem Maß. Immer einmal wieder hält sie mir vor, ich schwebte in den Wolken und hinge zu sehr gewiss anspruchsvollen, aber letztlich doch unnützen Überlegungen nach, währenddessen sie sich mit dem gesamten verbleibenden Rest herumzuschlagen habe.
Ich tue solche Kritik nicht leichtfertig ab, aber ich halte sie doch für nicht ganz fair. Immerhin bin ich es, der sich beispielsweise seit eh und je um die Steuererklärungen kümmert, indem er konstruktive Gespräche mit unserem Steuerberater führt und diesem die erforderlichen Unterlagen zukommen lässt. Anna hat bis heute nicht realisiert, dass wir seit langem einkommensteuerpflichtig sind und redet immer noch vom „Lohnsteuerjahresausgleich“, ein Wort, das sie vermutlich in ihrer Kindheit irgendwo aufgeschnappt hat. Ich habe seinerzeit sogar eigenhändig und nahezu ohne fremde Hilfe sämtliche Formulare für den Bauantrag ausgefüllt, obschon mir so etwas überhaupt nicht liegt. Außerdem führe ich regelmäßig den Hund aus, jedenfalls seit wir neuerdings einen besitzen und soweit ich dazu die Zeit habe, und am Wochenende decke in den Frühstückstisch.
Als das Jahr des Löchergrabens anbrach, hatten wir das Gefühl, uns eigentlich recht erträglich im Leben eingerichtet zu haben. Die Geschichte liegt schon eine gewisse Zeit zurück. Anna war vierunddreißig, ich siebenunddreißig, und unsere Söhne Max und Paul waren zehn und sieben. Wir waren eine richtig ansehnliche kleine Sippe – ein hübsches Paar, wie die Leute zu sagen pflegten, mit zwei wohlgeratenen, aufgeweckten Kindern. Wenn man sich die Fotos von uns ansieht, die damals im Urlaub an der Ostsee und bei uns im Garten gemacht wurden, denkt man: Na, was wollen die mehr? Eine sehr attraktive, mädchenhafte blonde Frau und ein kräftiger, ziemlich maskuliner Mann, zwei schlanke, hellhaarige Engel von Söhnen – vier strahlende Gesichter und eine Aura von Sonnenschein, der aus der Seele kommt.
Das mag jetzt ein wenig selbstgefällig klingen, aber so ist es nicht zu verstehen. Es war einfach so, dass wir einigermaßen zufrieden mit uns sein konnten und es auch waren, und das konnte man uns ansehen. Und was sonst noch ist, sieht man auf solchen Fotos ja sowieso nicht.
Ich bezog ein ansehnliches Einkommen und wir lebten angemessen: auf etwas gehobenem Niveau, vor allem, was Bildung und Geschmack angeht. Wir legten Wert darauf, dass unsere Kinder beizeiten Klavierunterricht erhielten. Wir gingen regelmäßig ins Theater und pflegten ein alles in allem sehr erfreuliches Sexualleben. Im Grunde genommen hätten wir es gar nicht nötig gehabt, ein Haus zu bauen, so wenig, wie wir es nötig hatten, aus Statusgründen eine bestimmte Automarke zu fahren. Nach wie vor ziehe ich unseren Volvo jedem Mercedes oder BMW vor, weil er einfach perfekt die Idee des Understatement verkörpert. Unsere Mietwohnung – mit Terrasse und eigenem Garten – war wirklich groß genug für uns, und der Mehrwert an Sozialprestige, den manche Leute mit dem Besitz eines Hauses verbinden, interessierte uns ziemlich wenig. Wir hatten, um es einmal so zu sagen, in unserem Dasein andere Prioritäten gesetzt als jene, die im strikt konventionellen Sinne zu gelten pflegen, was aber auch wieder nicht heißen soll, dass wir unbürgerlich lebten. Wir lebten nur etwas ungezwungener, etwas legerer, eben wie Leute, die Ende der Sechzigerjahre erwachsen geworden sind, ohne sich deswegen schon als ausgesprochene Achtundsechziger zu betrachten. Allerdings hatte ich auch nichts dagegen, wenn mich bestimmte Leute als „alten Achtundsechziger“ apostrophierten und mich dabei anguckten, als sei es ihnen völlig unbegreiflich, dass jemand in meinem Alter immer noch nicht richtig etabliert war. Manchmal wartete ich nur auf solche Situationen, um dann mit müdem Lächeln darauf hinzuweisen, dass es ganz und gar müßig sei, mich in irgendwelche Schubkästchen einordnen zu wollen.
Читать дальше