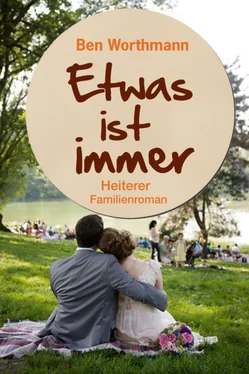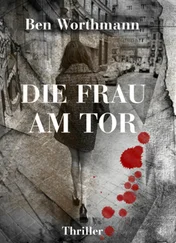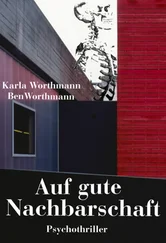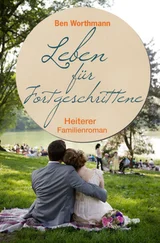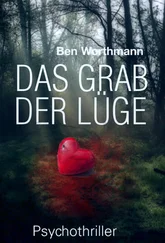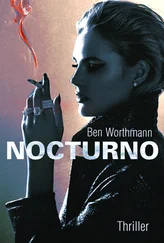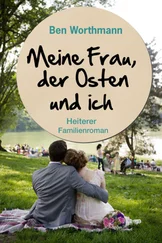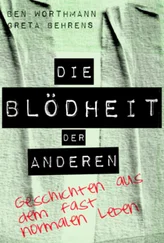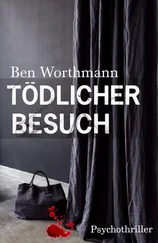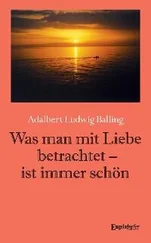Wer oder was ausgerechnet uns auf den Gedanken verfallen ließ, ein Haus zu bauen, haben wir im Nachhinein manchmal zu rekonstruieren versucht. Vielleicht war es, wenn man so will, doch ein gewisser unterschwelliger kompensatorischer Wunsch nach Konvention oder auch nur die Lust am trotzigen Kontrast zu den sonstigen, eher lässigen Inszenierungen unseres Daseins – oder womöglich auch von beidem ein bisschen. Als Hausbesitzer, dachte ich bisweilen, kannst du immerhin offen zeigen, wie wenig dir an Besitz liegt, indem du beispielsweise den Vorgarten verkommen oder den Zaun verrotten lässt, sodass die Nachbarn missbilligende Blicke herüberwerfen. Aber es war beileibe nicht so, als hätten derartige Fantasien mich nicht ruhen lassen und als hätte ich den wirklich dringenden Wunsch in mir gespürt, ein eigenes Haus zu haben. Im Grunde war es mir einfach egal, ob wir nun bauten oder nicht.
Anna war schon deutlich stärker an der Sache interessiert. Aber letzten Endes ist es uns nie gelungen, die Frage der Anstiftung zu diesem Projekt vollständig aufzuklären. Wir stießen aber immer wieder auf Indizien, die in Richtung „die Familie“ im Allgemeinen und die Schwiegermütter im Speziellen wiesen, wie es wahrscheinlich oft so ist.
„Wenn deine Mutter mit ihren spießigen Ansichten uns nicht dauernd in den Ohren gelegen hätte, hätten wir uns eine Menge Ärger ersparen können“, sagte ich dann und wann zu Anna und hatte damit zweifellos zumindest teilweise Recht.
Sie erwiderte: „Wenn wird das Haus nicht gebaut hätten, hätten wir das ganze Geld für irgendwelchen Blödsinn verplempert und es wäre jetzt weg.“ Das hatte ebenfalls einiges für sich.
Doch solche Dialoge endeten selten mit einer einvernehmlichen Schlussfolgerung. Man sollte überhaupt darauf hinarbeiten, den Konjunktiv irrealis völlig aus der menschlichen Kommunikation zu verbannen. Nichts Wesentliches bleibt ungesagt, wenn man alle Sätze mit „wenn“ und „hätte“ und „wäre“ einfach herunterschluckt. Im Sinne der Vermeidung unnötiger Streitereien wäre dies vielmehr eine vorzügliche Diät.
Übrigens haben wir inzwischen noch einen Sohn, und auch dieser Umstand steht in einem zumindest zeitlichen Zusammenhang mit den Ereignissen des Sterbens, Erbens, Begrabens und Bauens in dem besagten Jahr.
Einerseits angetrieben von dem Bemühen, der Wahrheit die Ehre zu geben, und andererseits darauf bedacht, nicht zu sehr ins Platt-Exemplarische abzugleiten, habe ich eine Weile gezögert, ob ich mir die Erwähnung dieser Familienvergrößerung im Zuge von Begräbnisfeiern und Richtfesten nicht lieber verkneifen sollte. Muss denn unbedingt, wo gestorben und gebaut wird, gleich auch noch neues Leben gezeugt werden? Es muss wohl. Tatsache bleibt jedenfalls, dass es so war. Ich kann es nicht ändern und will das auch gar nicht.
Manchmal entwickelt sich eben alles etwas symbolhaltiger, als man ursprünglich beabsichtigt hatte. Aber während es sich ereignet, bemerkt man es ohnehin nicht. Erst hinterher, wenn man in vergilbten Alben blättert oder die alten Sachen durchwühlt, von denen man nie genau weiß, ob sie in die Umzugskiste gehören oder in den Müllcontainer, fällt einem auf, wie trefflich und passgenau sich doch alles zusammengefügt hat. Und dann sitzt man da zwischen all dem Zeug und hat plötzlich das Gefühl: Völlig klar, dass es so kommen musste, wie es kam, schon deswegen, weil sonst das Leben seinem Ruf nicht gerecht werden könnte, dass es die merkwürdigsten Geschichten im Zweifelsfall immer noch selbst auf Lager hat.
Würde ich zum Beispiel sagen, dass, als unser Rohbau stand, mein Großvater, seine Schwester und sein Bruder unter der Erde lagen, so entspräche dies nicht ganz den Tatsachen. Zwar hätte es so sein sollen, denn alle drei waren schließlich tot und die in hiesigen Breiten übliche Beisetzungsmethode dürfte bekannt sein. Aber es kam etwas anders, und ohne den Geschehnissen allzu weit vorzugreifen, kann man sagen, dass die Umstände der Bestattung in einem Fall nicht von solcher Art waren, dass sich eine pauschale Feststellung wie „die drei lagen unter der Erde“ aufrechterhalten ließe.
Der Tag, an dem wir nach allerlei telefonischem Vorgeplänkel, den unvermeidlichen Konsultationen dieses oder jenes Experten sowie endlosen Beratungen im engsten Familienkreis – Teilnehmer: Anna und ich – zum ersten Mal beim Architekten saßen, um uns real existierende Baupläne anzusehen, war einer von diesen Tagen, an denen man schon morgens weiß, dass alles Mögliche passieren kann – man weiß nur noch nicht genau, was.
Wir kannten Ernst Stawitzki bis dahin nur vom Telefon, und die persönliche Begegnung mit ihm bedeutete für uns einen gelinden Schock. Er war ein großer, massiger Mensch, etwa in meinem Alter. Er war nachlässig gekleidet und hatte fettiges Haar, und er drückte sich in einem etwas unbeholfenen Deutsch aus – diesem typischen Gemisch aus technokratisch-wichtigtuerischen Floskeln und einem inkompetenten Alltagsjargon, das für Leute bezeichnend ist, die es auch ohne nennenswerte formale Bildung zu etwas gebracht haben. Nichts an ihm verriet auch nur entfernt etwas von jenen im weitesten Sinne kreativen Fähigkeiten, die man bei einem Konstrukteur und Designer von Bauwerken gemeinhin doch wohl erwarten darf. Er trug eine eiterfarbene Hose mit verstellbarem Bund und Gesundheitsschuhe und sein braunes Polohemd war drei Nummern zu eng. Er bot einen entsetzlichen Anblick. Mit solchen Leuten hatte ich normalerweise nichts zu tun. Ich war, um es einmal so auszudrücken, optisch und akustisch stark befremdet.
Er wirkte auf mich wie ein Parvenü, der es in Abendkursen und über zweite und dritte Bildungswege irgendwie geschafft hatte, sich Architekt nennen zu dürfen. Warum, ging es mir durch den Kopf, mussten wir unter hundert Möglichkeiten, uns ein Haus entwerfen zu lassen, ausgerechnet die Variante Stawitzki auswählen? Was dabei herauszukommen drohte, sah man ja an seinem eigenen Haus und an seinem Büro: alles protzig und teuer, aber ohne Stil. Dunkles Holz unter den Decken und pseudomodernes Stahlrohrmobiliar vor rustikalen Eichenwänden, wo in den Regalen ein paar Lexika und Reiseführer und etwas Nippes die Staffage bildeten – das Ganze sah schlimmer aus als aus einem Einrichtungskatalog. Die Antwort auf „warum Stawitzki?“ war indes verhältnismäßig einfach: Er war uns empfohlen worden, und zwar von unserer Bausparkasse. Und Tatsache war, dass wir über keinerlei Erfahrung verfügten, wie man Empfehlungen von Bausparkassen erfolgreich in den Wind schlägt, um die Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen.
Stawitzki wusste irgendwoher, dass ich bei der Zeitung im Politikressort arbeitete, und er begann sogleich auf die Regierung zu schimpfen. Es ist merkwürdig, aber einige Leute meinen, sie müssten einem irgendetwas bieten, sobald sie mitbekommen haben, dass man Journalist ist. Offenbar haben sie die Vorstellung, ein Journalist würde unentwegt mit Block und Stift durch die Welt laufen und alles notieren, was er hört und sieht. Sie denken, wenn sie jemandem wie mir etwas erzählen, das sie selbst für interessant oder gar originell halten, dann wird es vielleicht wie durch Zauberei irgendwie „in die Zeitung kommen“. Es ist wirklich absurd, welche Vermutungen in weiten Kreisen der Menschheit auch im sogenannten Medienzeitalter immer noch darüber existieren, wie eine Zeitung entsteht und worin die Beschäftigung von Journalisten besteht. Ich habe längst aufgehört zählen, wie oft ich schon äußerst unhöfliche Reaktionen unterdrücken musste, weil wieder einmal jemand, der Ärger mit seiner Autowerkstatt oder mit dem Finanzamt hatte, mir gönnerhaft den Rat geben zu müssen meinte: „Das sollten Sie mal in Ihrer Zeitung schreiben.“
Zu Stawitzki sagte ich, dass ich auch kein großer Freund der Regierung sei und seine diesbezüglichen Aversionen gut verstehen könne, aber genauso wenig sei ich ein Freund ausufernder Gespräche über Politik während meiner arbeitsfreien Zeit, denn mit Politik hätte ich dienstlich schon genug zu tun. Ich sagte das keineswegs in einem unfreundlichen Ton. Anna brauchte mir keinen ihrer ermahnenden Blicke zuzuwerfen, wie sie es meistens tut, wenn ich gegenüber anderen Leuten nicht so verbindlich bin, wie ich es ihrer Ansicht nach eigentlich sein sollte. Ich sagte zu Stawitzki, außerberuflich sei ich durchaus auch an anderen Dingen als an Politik interessiert. Ich wollte damit auf weiter gar nichts Besonderes hinaus. Welchen Anlass hätte ich auch gehabt, diesem Mann die Gewissheit zu ermitteln, dass er einen potenziellen Kunden mit breit gefächerten Interessen vor sich sitzen hatte? Doch prompt fragte er uns, ob wir uns für Musik interessierten. Natürlich bestätigten wir ihm das, ohne lange darüber nachzudenken. Es stimmte ja auch, und wer würde eine solche Frage schon mit Nein beantworten? Wir ahnten auch noch nichts weiter, als Stawitzki uns in ein Nebenzimmer bat, in dem außer ein paar Stühlen nur ein monströser nussbaumfarbener Kasten stand.
Читать дальше