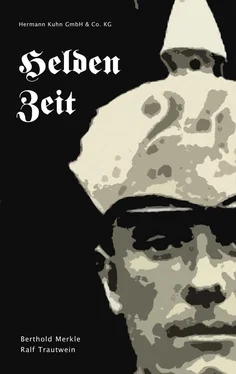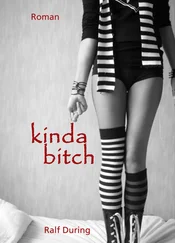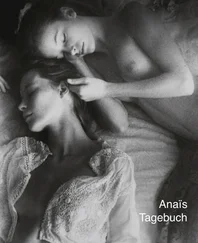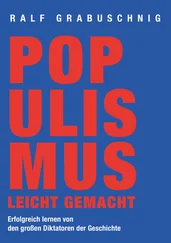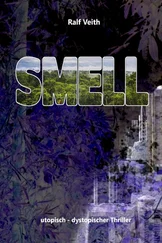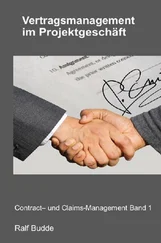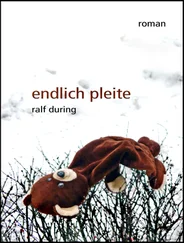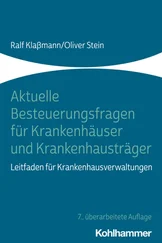„Pah, diese Sozis!”, knurrte Paul verächtlich, zerknüllte den Handzettel und warf ihn kopfschüttelnd zu Boden. „Vaterlandslose Gesellen. Georg, ich hätte dich im ‘Waldhorn’ nicht aufhalten dürfen. Wir hätten ihnen doch eine richtige Abreibung verpassen sollen.”
Georg machte sich an seinem Tornister zu schaffen. Es hatte zwar gut getan, Wehler mal richtig die Meinung zu geigen. Doch was ihnen nun bevorstand, wollte ihm nicht so recht schmecken. Im Gegensatz zu Paul war ihm jegliche gute Laune abhanden gekommen. Er wagte es nicht auszusprechen – doch hatten die Kriegsgegner nicht etwa ein Stück weit recht?
„Ich sehe diesen Krieg aber nicht positiv”, gab er trotzig zurück. „Die scheinen hier alle zu glauben, dass uns ein Spaziergang bevorsteht.”
„Mensch Georg, das wird auch nicht viel mehr werden als ein Spaziergang!” Paul knuffte ihn in die Seite. „Der Siebziger-Krieg war auch eine klare Angelegenheit. Wir sind Deutsche! Wir marschieren, der Franzos’ rennt. So ist das! Wir gehen dort rein und wieder raus und lassen uns danach das Eiserne Kreuz an die Brust heften.”
„Los, stellt euch auf! Alle Männer, die nach Ulm fahren, in Reihe aufstellen!”, dröhnte eine laute Stimme über den Vorplatz.
„Das ist doch der Haber, der Oberlehrer”, wunderte sich Georg.
„Tatsächlich”, staunte Paul. „Heute aber nicht als Oberlehrer, sondern als Oberleutnant.”
Adelbert Haber, so schien es, war der ranghöchste Schwenninger, der sich an diesem Tag anschickte, dem Befehl des Kaisers zu folgen. Als würde er seinen Pennälern an der Realschule Anweisungen geben, dirigierte der stattliche Mittvierziger nun die Reservisten in Reih’ und Glied. Georg, der schon fürchtete, Haber wolle die Männer erst einmal auf dem Bahnhofsvorplatz exerzieren lassen, erkannte nun den Grund für die Ambitionen des Reserveoffiziers: Ein Fotograf, der seine Kamera auf einem Dreibein aufgerichtet hatte, wollte die Soldaten auf Platte bannen. Neben ihm stand ein untersetzter Mann mit schütterem Haar und freundlichem Gesicht, dieser Reporter: Seiz. Georg hatte ihn schon ein paar Mal bei Konzerten der Eintracht gesehen. Katharina hatte ihn dorthin mitgenommen, weil ihr Bruder bei der Eintracht Bariton sang.
Katharina. In diesem Augenblick sah er sie. Sie stand in ihrem lila Kleid auf der anderen Seite der Bismarckstraße.
„Komm, du Träumer. Das Bild ist im Kasten.” Paul gab ihm einen Schubs. „Wartest du drauf, dass einer dein Gepäck mitnimmt? Vorsicht, sonst musst du zum Schluss noch hier bleiben ...”
Georg hätte in diesem Augenblick nichts lieber getan als das. Sie sah hinreißend aus. Das lange dunkle Haar fiel ihr weich über die Schultern, und ihr Lächeln war süß wie eh und je. In diesem Moment trat ein Soldat auf sie zu, ein hochgewachsener, schlanker junger Mann, und legte den Arm um sie. Dieser Lehrer!
Paul zog seinen Freund am Arm. Auch er hatte Georgs Verflossene bemerkt. „Komm, lass’ sie.”
„Der Teufel soll diesen verdammten Schulmeister holen”, knurrte Georg. Er konnte seinen Blick einfach nicht von ihr losreißen.
„Los, das Vaterland ruft. Andere Mütter haben auch schöne Töchter.”
„Oh Mann! Wir oft habe ich diesen Spruch schon gehört. Du hast wirklich gut reden.”
Georg wandte sich ab und folgte Paul zu der Stelle, wo sie ihr Marschgepäck abgestellt hatten. Sie schnallten die Tornister auf und schlenderten Richtung Bahnsteig, wo die Dampflok heranschnaufte. Jetzt war es so weit: Sie zogen in den Krieg.
KAPITEL 18 - DIE WACHT AM RHEIN
SCHWENNINGEN, 3. August 1914, 11.05 Uhr. Christian verstaute sein Marschbündel unter dem Sitz. Er nahm die Mütze ab und schob sich auf die harte Holzbank. Haber, der ihm gegenüber Platz genommen hatte, musterte ihn zufrieden. Im Zug ging es eng her, aber Haber genoss aufgrund seines Ranges Respekt und hatte sich schnell Platz verschafft. Für ihn stand außer Frage, dass sein junger Kollegen bei ihm sitzen würde. Karl Dörfler und Jakob Maier, beide Lehrer an der Fachschule, setzten sich zu ihnen. Dörfler trug nun die Rangabzeichen eines Leutnants, Maier die eines Unteroffiziers.
„Habt ihr das gesehen?”, fragte Dörfler begeistert: „Da hat einer auf den Eisenbahnwaggon gepinselt: ‚Über Ulm nach Paris in zwei Wochen’ – ha, so ist’s recht!” Er lachte. Auch Haber und Maier amüsierten sich köstlich über die kriegerische Parole. Christian hatte beim Einsteigen noch andere Sprüche auf der Wand des Wagens entziffert, etwa: „Auf zum Preisschießen nach Paris”.
„Rapp, mein junger Freund”, fing Haber gönnerhaft an, „jetzt kommt die Stunde der Bewährung. Auch für Sie als Unteroffiziersaspiranten.” Die Beförderung zum Unteroffizier war Christian zum Ende seiner Dienstzeit verwehrt geblieben. Er war als Aspirant abgegangen, was ihn aber nicht weiter gestört hatte. Er war vor allem froh gewesen, den Rock des Kaisers abstreifen und seinem Beruf nachgehen zu können. Er war sehr gerne Lehrer, und er hätte viel dafür gegeben, jetzt nicht ins Feld zu müssen.
„Ihre neuen Stiefel sind auf jeden Fall eines Unteroffiziers würdig”, grinste der Kollege Maier.
Christian lächelte. „Dafür habe ich auch den Sold eines Generals auf den Tisch gelegt!”
„Bravo, junger Freund, bravo. So ist es recht!” Haber amüsierte sich köstlich. „Mit solchen Stiefeln marschiert es sich ganz von allein nach Paris! – Die Damen werden sich dort nach Ihnen umdrehen. Und über die Französinnen erzählt man sich ja so manches!” Er lachte dröhnend. Maier und Dörfler lachten mit. Christians neues Schuhwerk bot noch Anlass zu weiteren Sprüchen, und bald herrschte Einigkeit im Abteil der uniformierten Lehrer, dass einem guten Patrioten keine Investition in den Krieg zu hoch sein dürfe. Haber, Dörfler und Maier waren überzeugt davon, dass der Feind Deutschlands Soldaten nicht lange standhalten würde.
„Ihr werdet sehen”, sagte Dörfler, „schon in ein paar Wochen werde ich wieder hier in Schwenningen sitzen und unseren Uhrmachern zeigen müssen, wie der Hase läuft.”
„Aber vorher sind erst mal die Franzosen dran”, warf Maier ein.
Abgesehen von Christian, dessen Gedanken ständig zu Katharina flogen, waren sie bester Stimmung. Haber ließ sie wissen, dass er beabsichtige, es in Frankreich alsbald zum Hauptmann zu bringen, und auch die beiden anderen spekulierten auf eine baldige Beförderung.
Im Waggon begannen einige Männer „Die Wacht am Rhein” zu singen. Von diesem Soldatenlied aus dem Siebziger-Krieg kursierten bereits viele Persiflagen, aber die Schwenninger Patrioten dachten nicht daran, den martialischen Originaltext auf ihrem Weg in die Kaserne zu verfremden. „Der Rhein, Teutschlands Strom, nicht aber Teutschlands Grenze”, zitierte Haber mit hochgerecktem Zeigefinger Ernst Moritz Arndt, bevor er mit seinem tiefen Bass begeistert einfiel: „Lieb’ Vaterland, magst ruhig sein, Fest steht und treu die Wacht am Rhein!”
Sie sangen aus voller Brust: „Solang ein Tropfen Blut noch glüht, noch eine Faust den Degen zieht, und noch ein Arm die Büchse spannt, betritt kein Feind hier deinen Strand ...” – Christian konnte nicht umhin, sich im Stillen zu fragen, ob die Kameraden bedachten, dass sie nun ja wohl keinesfalls beabsichtigten, am Rheinufer Halt zu machen. „Reich wie an Wasser deine Flut, ist Deutschland ja an Heldenblut ...”
Haber erzählte nicht ohne Stolz, dass er am Sedantag Geburtstag habe. Am 2. September gedachten die deutschen Patrioten des großen militärischen Triumphs über Frankreichs Rheinarmee, als es den Deutschen gelungen war, bei Sedan anno 1870 den Franzosenkaiser gefangen zu nehmen und den Gegner, der ihnen als „Erbfeind” galt, schwer zu schlagen.
General Helmuth von Moltke hatte nach der Schlacht bei Beaumont fast zweihunderttausend Mann in Eilmärschen hinter den angeschlagenen französischen Truppen nach Sedan hergeschickt; seine Spitzenverbände hatten schließlich am 31. August die Gegend um das Städtchen unweit der belgischen Grenze erreicht und die Franzosen zur vorentscheidenden Schlacht des Krieges gestellt.
Читать дальше