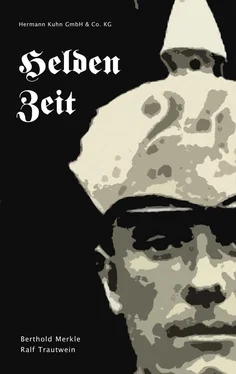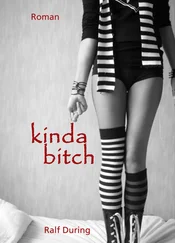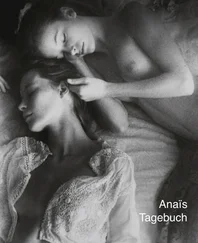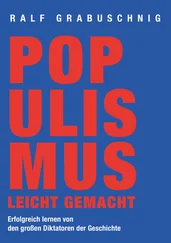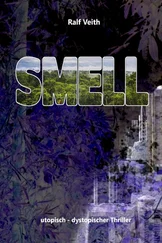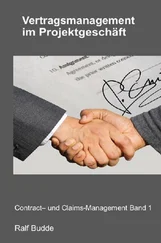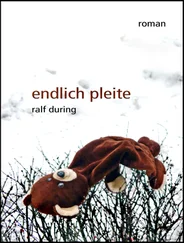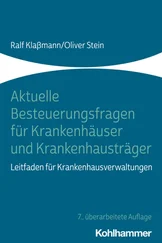1 ...8 9 10 12 13 14 ...18
KAPITEL 11 - DIE STUNDE DER FALKEN
WIEN, 27. Juli 1914, 8.10 Uhr. Berchthold lächelte jovial. „Wünsche wohl geruht zu haben, Herr General!”
„Ganz hervorragend, Herr Außenminister, ganz hervorragend!” Franz Conrad von Hötzendorf hatte tatsächlich schlecht geschlafen und verspürte keine Lust auf Geplänkel. Er wollte am liebsten gleich zur Sache kommen. Berchthold allerdings konnte es sich nicht verkneifen, weiter zu sticheln. Er schien bester Laune. „Es ruht sich doch gleich viel besser, wenn man nicht jeden Tag damit rechnen muss, abberufen zu werden, nicht wahr?” Er spielte darauf an, dass der alte Kaiser den zuvor ungeliebten Hötzendorf in dieser Situation tatsächlich mehr denn je brauchte.
Auf Conrad von Hötzendorfs Stirn bildete sich eine tiefe Falte. „Herr Minister, ich muss doch bitten!”
Berchthold grinste.
„Unsere Teilmobilmachung läuft auf Hochtouren. Morgen sind wir so weit”, stellte Conrad von Hötzendorf fest.
„Dann ist morgen also der Tag! Gut so.”
„Von mir aus, lieber Graf, gerne. Wir haben lange darauf warten müssen. Wie stellt sich die Lage aus Ihrer Sicht dar?”
„Nehmen wir doch erst einmal Platz, lieber Conrad.” Die Männer setzten sich. Immer, wenn sie sich unter vier Augen sprechen wollten, trafen sich die Habsburger Falken im Augustinertrakt der Hofburg, der an die kaiserliche Bibliothek angrenzte. Hier konnte man sich ungestört besprechen.
In einer Ministerratssitzung vor gut einer Woche hatten sich die Entscheidungsträger der Donaumonarchie darauf verständigt, Serbien ein für allemal zu erledigen. Berchtholds Strategie, nach Möglichkeit kein serbisches Territorium zu annektieren, Serbien aber durch Abtretung großer Gebiete an befreundete Balkanstaaten zu schwächen, war auf einhellige Zustimmung gestoßen. Berchtold hatte dem russischen Außenminister Sasonow daraufhin geflissentlich versichert, dass man keineswegs beabsichtigte, sich serbisches Territorium einzuverleiben, sondern lediglich gedenke, sich zu verteidigen – im Falle eines Falles. Mit dieser Finte, glaubte er, habe man Zeit gewonnen.
„Ich habe Neuigkeiten von Giesl”, sagte der Außenminister. Wladimir Giesl war sein Gesandter in Belgrad. Er hatte den Serben jenen ultimativen Forderungskatalog überbracht, in dem die Österreicher von der serbischen Regierung unter anderem die kritischen Ermittlungen gegen die Teilnehmer des Komplotts vom 28. Juni unter der Aufsicht österreichischer Beamter verlangt hatten. Conrad wusste ebenso gut, wie Berchtold es gewusst hatte, dass sie mit ihrem Ultimatum die Lunte eines Pulverfasses in Brand gesetzt hatten. Es war ein kalkulierter Affront gewesen.
„Giesl hat am frühen Morgen telegrafiert, dass die Serben unsere Begehrnote als inakzeptabel ansehen. Sie haben insgesamt erstaunlich geschickt geantwortet. Das muss ich ihnen zugestehen. Aber eine Untersuchung durch unsere Ermittler lehnen sie ab.”
„Welch eine Überraschung!”, lachte Franz Conrad von Hötzendorf hämisch.
„Was gibt es aus Ihrer Sicht Neues von unseren russischen Freunden?”, wollte Berchtold wissen.
„Nun, ihre Teilmobilmachung ist angelaufen. Säbelrasseln! Die Deutschen glauben nach wie vor nicht daran, dass es die Russen ernst meinen.”
„Ja, die Deutschen! Und Sie, lieber Conrad?”
„Was weiß ich? – Selbst für den Fall, dass sie es ernst meinen sollten: Die Russen sind mir egal, schließlich haben wir das Deutsche Reich auf unserer Seite. Da ist mir nicht bange! Endlich, Berchtold, endlich ist es so weit, dass wir gegen die Serben losschlagen können.” Seine Augen leuchteten. Die Enden seines weißen Schnurrbarts zitterten vor Erregung, während sich Conrad in Rage redete.
„Jahrelang hat Ihr Vorgänger meine Bestrebungen diesbezüglich konterkariert. Mit Ihnen ist das etwas ganz anderes, Berchtold! – Sie sind ein Diplomat. Aehrental war ein Tölpel!”
„Aber, aber, jetzt bin ich es, der bitten muss, lieber Conrad!” Berchthold grinste breit.
„Es ist doch wahr! Aehrenthal hat Bosnien und die Herzegowina ohne Gegenleistung für die Russen annektieren lassen. Der Mann hat uns politisch isoliert. Den ganzen Ärger, den wir in den letzten Jahren hatten, hätten wir uns mit einem anderen Außenminister erspart. Und der Alte hat ihn machen lassen ...”
„Ja, wenn der Alte nur mal besser auf Sie gehört hätte, anstatt Sie abzusägen.”
„Mit dem Attentat auf den Thronfolger hat unser geliebter Kaiser seine Lektion gelernt.”
„Ich sehe: Wir ziehen beständig an einem Strang, Herr General. Aber zurück zu den Deutschen: Nimmt Bethmann Hollweg unsere Bestrebungen in Sachen Serbien für bare Münze?”
„Zweibund hin, Zweibund her – die Deutschen hätten uns keinen Blankoscheck ausgestellt, wenn sie nicht längst ihre eigenen Pläne geschmiedet hätten. Das schließe ich nicht zuletzt aus der Geschwindigkeit, in der Wilhelm uns seiner Bündnistreue versichert hat. Bedenken Sie außerdem: Der deutsche Reichskanzler ist ein kluger Mann. Er weiß, dass eine Aktion gegen Serbien Krieg bedeutet. Wir können uns auf ihn verlassen. Das Deutsche Reich ist stark, und ein großer Krieg wird die Verhältnisse auf diesem Kontinent grundlegend verändern.”
„Natürlich in unserem Sinne ...”
„Selbstverständlich!”
Berchtold war davon überzeugt, dass ein bewaffneter Konflikt dazu beitragen würde, den Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn zu stabilisieren. Wie General Franz Conrad von Hötzendorf auch empfand er Serbien als permanente Bedrohung, als einen Stachel im Fleisch der k.u.k.-Monarchie, den er nun endgültig auszureißen gedachte.
„Wenn Serbien erst einmal am Ende ist”, meinte der Außenminister, „dann stirbt auch der panslawistische Gedanke in Europa. Er wird vertrocknen wie ein Pflänzchen, das keiner mehr gießt. Ihr werdet es sehen, Conrad.”
Der alte Soldat nickte zustimmend: „Soll er sterben! So wie unser Thronfolger gestorben ist.” Conrad von Hötzendorf ballte die Faust.
Berchthold nickte. Die Stunde der Habsburger Falken war endlich gekommen.
KAPITEL 12 - ENGLÄNDER UND WÜRTTEMBERGER
SCHWENNINGEN, 29. Juli 1914, 20.10 Uhr. Kaiser Wilhelm II. war gut erholt und ebenso gut gelaunt von seiner Nordlandreise nach Berlin zurückgekehrt. Er hatte vorgeschlagen, Österreich solle Belgrad kurzerhand als „Faustpfand” besetzen, um seine im Ultimatum gestellten Forderungen durchzusetzen. Ein Krieg sei wohl nicht mehr nötig. Als der Monarch schließlich das ganze Ausmaß der Gefahr erkannte, war es tatsächlich schon zu spät. Schon tags darauf hatte k.u.k.-Außenminister Graf Berchthold Serbien den Krieg erklärt.
Wie würde es nun weitergehen?
Stadtschultheiß Dr. Braunagel und der zweite Mann im Schwenninger Rathaus, Ratsschreiber Kohler, hatten sich vorgenommen, den Schock darüber mit einer Flasche Wein im „Kronprinzen” zu betäuben. Hier pflegten die beiden Männer, die gut miteinander auskamen und sich gegenseitig hoch schätzten, des öfteren einzukehren.
Mit ihnen zu Tisch saß ein kräftiger Mann Anfang fünfzig, der beim Wirt einen ganz erlesenen Württemberger Wein orderte. Jakob Kienzle hatte sein Unternehmen zu einem der wichtigsten Uhrenhersteller im Land gemacht; er hatte außerdem ein Werk in Böhmen und Filialen in Mailand und Paris eröffnet. Als Erster hatte Kienzle Dampfmaschinen in der Produktion eingesetzt und begonnen, Uhren in Serie zu fertigen. Er war einer der reichsten Männer Schwenningens, was das Geld betraf ebenso wie den politischen Einfluss. Für ihn arbeiteten mittlerweile fast eintausendfünfhundert Menschen.
Hotelier Franz Schäfer ließ es sich nicht nehmen, diese wichtigen Herrschaften persönlich zu bedienen. Als er ihnen aus der wohltemperierten Flasche eingeschenkt und sie am Tisch wieder alleine gelassen hatte, seufzte Kienzle.
Читать дальше