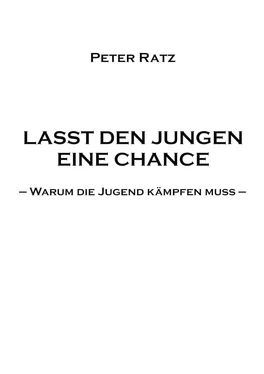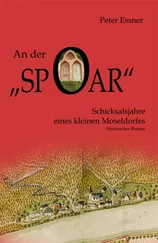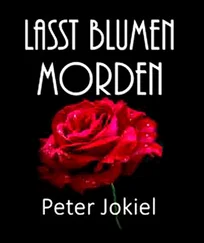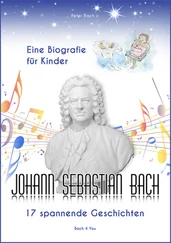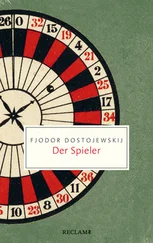Die Erfindung des Geldes hat es leicht gemacht, große Mengen an Wert zu erwerben und anzuhäufen. Der Handel bot die besten Möglichkeiten, rasch reich zu werden. Er hatte natürlich auch seine Risiken. Unvorhersehbare Unbilden des Wetters setzten der Schiffahrt zu, Piraten ebenfalls. Auch auf dem Lande war man vor Überfällen nicht sicher, ebenso wenig vor betrügerischen Geschäftspartnern. Flüsse, Überschwemmungen, Brände und sonstige höhere Gewalt führten immer wieder zum Verlust der Waren. Dem gegenüber stand die Aussicht auf den Gewinn. Denn die Ware weiterzureichen, oft über lange und gefährliche Transportwege, war immer verbunden mit einem Aufschlag auf den Preis, zu dem man selbst etwas erwarb.
Der Verkaufspreis war und ist außerdem, vielleicht auch überwiegend, abhängig davon, welche Erwartungen der mögliche Käufer mit dem angebotenen Produkt verbindet. Der in der Vorstellung angenommene Wert bestimmt den Preis, der für ein Produkt erzielt werden kann. Dabei können geradezu phantastische Missverhältnisse zwischen wirklichem und eingebildetem Wert auftreten. Es sei an das Tauschgeschäft erinnert, bei dem Indianer wertvolle Pelze gegen nahezu wertlose Glaskugeln eintauschten, ein Produkt, das gefiel und das sie nicht kannten. Ist das heute anders? Es sei an das Wort eines der ganz Großen aus der kosmetischen Industrie wiedergegeben. War es Yves Laurent? Er sagte: „Wie verkaufen nicht das Produkt, wir verkaufen die Illusion.“
Immer schon hat der Mensch sich in Gruppen organisiert. So lange er sein Leben durch Sammeln und Jagen fristete, konnte er wegen der Nahrungsmittelversorgung nur kleinere Trupps bilden. Aber mit Beginn des Ackerbaus entstanden die Voraussetzungen, die größere Menschenansammlungen entstehen ließen. Der Anbau von Feldfrüchten und die Haltung von Nutzvieh schufen eine verlässliche Lebensgrundlage. Man musste nicht mehr umherziehen. Bei den Wanderungen konnte man immer nur das wirklich Notwendige an Gerätschaften bei sich führen. Die sesshafte Lebensweise aber machte es möglich, mehr zu haben als man transportieren konnte. Waren bisher nur Zeichen- und Schnitzarbeiten als Ergebnis kulturellen Ausdrucks möglich, entwickelte der Sesshafte im Laufe der Zeit die vielfältigsten Formen kulturellen Schaffens und Lebens. Man brauchte mehr und verschiedenartigere Waren als früher, ein Anreiz für Produktion und Handel. Die einzelnen Siedlungsräume waren oft weit von einander entfernt, misst man die dazwischen liegenden Strecken in Tagesmärschen. Die Transportmittel waren langsam, der Transport selbst beschwerlich. Deshalb lebten die Menschen trotz der Handelsbeziehung abgeschieden von einander mit der Folge, dass sie ihre jeweils eigenen Kulturen entwickeln konnten. Die Gleichartigkeit innerhalb des eigenen Kulturraums und die Feststellung, dass man sich selbst von anderen abhob, rief ein Zusammengehörigkeitsgefühl hervor, das die Menschen zu einer Schicksalsgemeinschaft formte. Die Völker schlossen sich zu Staaten unterschiedlicher Form zusammen. Sie pflegten ihre kulturelle, politische und wirtschaftliche Eigenständigkeit.
Dienen die beschriebenen Entwicklungen einer Abgrenzung gegen andere, so ist der Handel darauf ausgerichtet, Grenzen zu überschreiten auf der Suche nach Waren und Kunden. Die Grenzen eigenen Handelns werden immer weiter hinaus geschoben, bis sich die wirtschaftlichen Beziehungen über den ganzen Erdball spannen. Auf dieser Suche nach neuen Waren und Kunden führt der Weg immer weiter hinein in den Lebensraum anderer Völker. Der Ausdehnungsdrang ist ein Teil des Wesens von jeder Art des Handels. Er führte schon im Altertum zu Handelswegen, die kaum vorstellbare Ausdehnungen erreichten. Waren gelangten von Europa bis nach China. Heute errreichen sie die entlegensten Winkel der Erde. Kein Volk bleibt davon ausgenommen. Die Verkehrswege, über die Handelsware transportiert wird, sind so dicht wie noch niemals zuvor. Die Transportmittel können jeden Punkt der Erde erreichen. Die heutigen niedrigen Transportkosten führen denn auch dazu, dass wir in den industrialisierten Ländern Waren aus allen Teilen der Welt zu unserer Verfügung haben. Ein Einkauf alltäglicher Lebensmittel in einem Supermarkt ergab ein erstaunliches Ergebnis. Die Transportwege für die Lebensmittel summierten sich zu einer Gesamtstrecke von 20.000 Kilometern! Man hatte Kiwis aus Neuseeland, Fleisch aus Argentinien, Fisch aus Vietnam und Äpfel aus Südafrika mit im Korb.
Die niedrigen Transportkosten führen nicht nur zu einer gewaltigen Fülle des Angebots. Sie haben es auch den Produzenten möglich gemacht, dort ihre Waren herstellen zu lassen, wo sie am wenigsten dafür bezahlen müssen. So wird ihr Gewinn am größten. Die weltweite Vernetzung von Rohstoffgewinnung, Produktion und Handelsbeziehungen heißt Globalisierung.
Soweit Handel und Geldgeschäfte innerhalb nationaler Grenzen abgewickelt werden, bleibt alles für die entsprechenden Behörden und Regierungen kontrollier- und steuerbar. Große Firmen und große Geldanleger, die an vielen Stellen der Erde tätig sind, lassen sich von nationalen Einrichtungen nicht in die Karten schauen. Diese weltweiten Spieler (nichts anderes heißt „ Global Players) nutzen die Unterschiede der Gesetze in den verschiedenen Ländern zu ihrem Vorteil. Sie kennen auch die Rivalitäten der einzelnen Regierungen, heizen sie an und nutzen sie aus. “Teile und herrsche“, der Spruch der alten Römer hat nichts von seiner Geltung verloren. Die Anstrengung einsichtiger Europäer, das Handeln der Großen in Produktion und Finanzen gültigen Gesetzen zu unterwerfen, hat bisher wenig Früchte gebracht. Viele der Parlamentsmitglieder sind kurzsichtig und/oder den Finanzstarken verpflichtet.
LOBBYISMUS
Eine nicht enden wollende Debatte beschäftigt sich mit den Beziehungen von „Entscheidungsträgern“ in Politik und Verwaltung zur Welt der Wirtschaft und Finanzen. Weite Teile der Bevölkerung sind davon überzeugt, dass sehr viele Politiker der Versuchung nicht widerstehen können, auf einträgliche Angebote einzugehen und dafür ihren Einfluss in der von außen gewünschten Weise einzusetzen. Die Kontakte von der Wirtschaft zur Politik werden über Lobbyisten hergestellt. Das sind Frauen und Männer, die im Auftrage der Wirtschaft und der Interessenverbände versuchen, Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung dazu zu bewegen, die Interessen ihrer Auftraggeber zu unterstützen. Die bei diesen Bemühungen eingeschlagenen Wege sind zahlreich. Wie intensiv die Bearbeitung ist, kann man daran ermessen, dass alleine in Brüssel etwa 15000 (fünfzehntausend) Interessenvertreter tätig sind. Auf deren Rolle wird in dem Kapitel „Demokratie und Politik“ näher eingegangen. Aber soviel sei hier schon angemerkt: der Einfluss großer Wirtschaftsverbände auf politische Entscheidungen ist gewaltig. Gesetze werden oft von Unternehmen gestaltet, Beschlüsse von ihnen bestimmt. Das macht es für aufrichtige Politiker und Verwaltungsbeamte so schwer, für die Kleinen und Mittleren einzutreten und für Ausgewogenheit zu sorgen, sowie die ausufernden Forderungen der Grossen einzudämmen.
INVESTITIONSSCHUTZABKOMMEN
In der Sendung der Fernsehdokumentationsreihe MONITOR 2013/0606 wird offen gelegt, auf welch undurchsichtige Weise Ansprüche ausländischer Investoren, die sie gegen die Bundesrepublik Deutschland erheben, geregelt werden. Die Ansprüche werden nicht, wie sonst verpflichtend, von regulären Gerichten beurteilt und entschieden. Ein Parallelrecht wurde eingerichtet, nach dem Zahlungen in Milliardenhöhe auf eine Art und Weise geregelt werden, die weniger an Rechtspflege als an Schiebereien denken lassen. Es macht nachdenklich, dass die Politiker alles so geschehen lassen. Auch unsere höchsten Gerichte nehmen an so weit außerhalb normaler Rechtspflege liegenden Verfahren keinen Anstoß. Es stört sie auch nicht, dass in der EU wie in Deutschland Gesetze gelten, die eine ungeheuere Benachteiligung inländischer Unternehmen gegenüber ausländischen Investoren darstellen.
Читать дальше