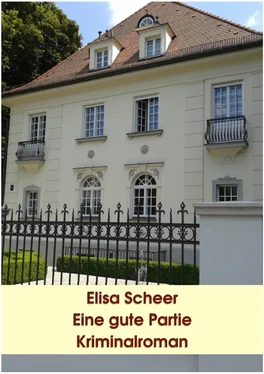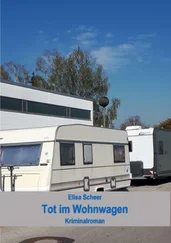Gut, es konnte mir ergehen wie in Herbstmilch , vielleicht heiratete ich einen Schwung ältlicher Verwandter mit, denen ich die Zehennägel schneiden und das Essen pürieren musste – aber da war ich doch wenigstens nicht zu ergebener Freundlichkeit verpflichtet!
Die Idee gewann immer mehr an Reiz. Eigentlich würde es mir besser gehen als vorher – und dieser Mann wusste doch wohl, dass er sich vielleicht eine pflichtbewusste, aber garantiert keine liebende Ehefrau gekauft hatte! Ich würde ihm jedenfalls nichts vorspielen.
Ganz arm konnte er nicht sein, wenn Papa die Sache mit der Viertelmillion nicht erfunden hatte. Zuzutrauen wäre es ihm freilich! Dass der Mann reich war, verwies ich aber doch ins Reich der Fabel, Papa hielt jeden Menschen für reich, der Geld besaß, dass er selbst gerne gehabt hätte. Und Tobi war genauso: Nur sie beide selbst waren arm, weil es nie für das Partykönig- und Playboydasein reichte, das ihnen vorschwebte. War Papa dafür nicht eigentlich zu alt? Wie alt war er jetzt? Sechsundfünfzig? Was wollten junge Frauen von so einem? So schön war er schließlich nicht, Stil hatte er auch keinen, und er war verheiratet (aber das band er den Mädels sicher nicht auf die Nase).
Ich ging den halben Samstagnachmittag durch den trüben Spätjanuartag spazieren und überlegte. Alles in mir sträubte sich dagegen – ich wollte doch später mal ein Leben für mich alleine haben, damit wäre es dann vorbei.
Aber zu Hause war es auch nicht mehr auszuhalten, und wenn ich nein sagte, würde das nur noch schlimmer. Das Argument hatte ich schon von allen Seiten beleuchtet – was gab es denn noch? Mir fiel nichts mehr ein, und ich kehrte um und ging nach Hause zurück. Als ich um die Ecke bog, stand ein Ambulanzwagen vor der Tür.
O Gott! Ich blieb einen Moment wie erstarrt stehen, dann rannte ich los, die Einfahrt entlang, durch die offene Haustür, ins Wohnzimmer. Mama lag auf dem Sofa, mühsam atmend, ein Sanitäter zog gerade die Nadel einer Spritze aus ihrem Arm und tätschelte ihr die Hand, der andere räumte seinen Koffer wieder ein.
„Nichts Ernstes, Herr Roth“, meinte der erste, „aber achten Sie darauf, dass ihre Frau sich nicht aufregt. Das Herz scheint etwas ungleichmäßig zu schlagen. Sie sollten vielleicht doch mal das Herzzentrum in München aufsuchen, dort könnte man eine präzisere Diagnose stellen, Langzeit-EKG und so. Ich lasse Ihnen ein Informationsblatt da, wenn Sie wollen.“
Papa nickte und nahm das Blatt, das er dann achtlos auf den Esstisch legte. Dann fiel sein Blick auf mich. „Wo warst du?“
„Spazieren. Was ist mit Mama?“
„Sie hatte Schmerzen und bekam keine Luft mehr.“
„Was war vorher? Hat sie sich aufgeregt?“
„Ja... sie konnte das Buch nicht finden, das sie lesen wollte. Wo hast du es hingelegt?“
„Welches Buch?“
Der zweite Sanitäter betrachtete Papa mit gerunzelter Stirn. „Schuldzuweisungen bringen in solchen Fällen gar nichts.“
O doch! Ich wusste, was Papa vorhatte – ab jetzt würde jeder Anfall Mamas meine Schuld sein, weil ich ihn nicht gerettet hatte. Er musste dann gar nicht mehr da sein, um das explizit zu sagen... ich hätte es längst verinnerlicht und würde mein Leben damit verbringen, nichts zu tun, was Mama aufregen konnte. Und sie regte sich leicht auf, über Kleinigkeiten, darüber, dass sie nicht mehr aussah wie fünfundzwanzig, dass ihr Buch nicht da lag, wo sie es gesucht hatte, dass der Tee zu stark, der Fisch zu fettig und ihr Appetit zu schwach war, dass ich nicht da war, wenn sie mich brauchte, dass ich nicht freudig genug sprang, wenn sie überlegte, was ihren Appetit vielleicht – vielleicht! – reizen konnte, dass ich zu Tobi unhöflich war... Nicht etwa darüber, dass ihr Sohn ein egozentrischer Versager war, ihre Tochter hier versauerte und ihr Mann sie seit Jahren betrog! Und alles, aber auch alles wäre meine Schuld!
Ich sah Papa quer durchs Zimmer in die Augen. „Okay“, sagte ich dann. Er nickte in sofortigem Verstehen, und ich machte mich daran, das Buch zu suchen. Ich fand es auf Mamas Nachttisch, wo sie es selbst vergessen hatte, brachte es ihr, wickelte die Decke fester um sie, brachte die Sanitäter zur Tür, kochte schwachen Tee und legte leise Barockmusik auf, wie Mama sie liebte.
„Alles in Ordnung?“
Sie nickte müde, also verließ ich sie und betrat das Arbeitszimmer, ohne zu klopfen. Papa hatte gerade den Hörer abgenommen und legte hastig wieder auf, als ich eintrat.
„Ich habe einige Bedingungen. Erstens: Du besorgst eine kompetente Pflege für Mama.“ Er nickte, und ich wusste genau, er würde es nicht tun.
„Ich schreibe dir alles auf und will eine Unterschrift von dir, also verlass dich lieber nicht darauf, dass ich das sofort wieder vergesse.“
Er nickte wieder.
„Zweitens: Du denkst dir eine Geschichte für Mama aus, warum ich plötzlich einen Unbekannten heirate und verschwinde. Drittens: Du besorgst mir die Faxnummer von dem Kerl. Ich will ihn vor der Trauung nicht sehen und nichts von ihm wissen, er soll nicht glauben, dass das etwas anderes als ein Geschäft ist. Wir werden alles per Fax regeln.“
„Du hast doch gar keins!“
„Ich nicht, aber ich weiß, wer eins hat. Das genügt ja wohl. Den Termin soll der Kerl festsetzen. Standesamt reicht, ich kann bei einem Vertragsabschluss auf Gottes Segen verzichten. So, jetzt kannst du ihn anrufen.“ Damit verließ ich das Zimmer, ohne Papa Gelegenheit zu einer Antwort zu geben.
In meinem Zimmer schaltete ich den Computer ein und tippte das Dokument, mit dem Papa sich verpflichten sollte, für Mama kompetente Pflege sicherzustellen und mir nach der Hochzeit nicht mehr unter die Augen zu kommen. Worauf konnte ich ihn noch festnageln? Dass er seine Finanzen in Ordnung brachte? Nein, das war wirklich ganz alleine sein Problem. Ich druckte das ganze aus, samt Ort und Datum, und brachte es ihm. Papa unterschrieb widerspruchslos und reichte mir einen Zettel mit der Faxnummer.
„Er war ein bisschen erstaunt, aber er meinte, wenn du es so willst...“
Ich warf einen Blick ins Wohnzimmer, wo Mama döste, schaltete den CD-Player wieder ein und machte mich daran, das erste Fax zu entwerfen.
Wie sollte ich ihn anreden? Ich kaute auf einem Bleistift herum und überlegte, dann beschloss ich, die Anrede einfach wegzulassen, und tippte zügig drauf los.
Bitte regeln Sie alles für die standesamtliche Trauung nach ihrem Gutdünken und teilen Sie mir mit, wohin ich welche Dokumente schicken soll. Ich nehme an, dass man eine Geburtsurkunde braucht, ansonsten kenne ich mich nicht aus.
Es genügt, wenn Sie mir den Termin der Zeremonie und den Dresscode mitteilen. Wenn Sie einen Ehevertrag wünschen, informieren Sie mich bitte, wann ich wo was unterschreiben soll – aber bitte nicht in Ihrer Gegenwart.
Mit freundlichen Grüßen, Nathalie Roth
Ich las mir alles noch einmal durch und löschte dann das Mit freundlichen Grüßen wieder. Dann schrieb ich die Faxnummer vom Trieste dazu und druckte das Dokument aus. Tiziano war mit mir zur Schule gegangen, konnte den Mund halten, kam als Juniorchef jederzeit an das Fax im Büro seines Vaters heran und der Laden hatte täglich von elf bis Mitternacht geöffnet – auch heute. Ich steckte das Schreiben sorgfältig in eine Hülle, nahm etwas Geld mit und machte mich auf ins Trieste, wo am späten Samstagnachmittag nicht gerade viel los war. Tiziano stand hinter der Bar und zwinkerte mir zu. Ich setzte mich zu ihm, akzeptierte ein Glas Bardolino und setzte ihm mein Anliegen auseinander.
„Kein Problem. Wenn du mit deinem Wein fertig bist, gehen wir ins Büro.“
„Lieber gleich, es kann sein, dass ich schnell eine Antwort kriege, dann kann ich doch gleich hier darauf warten.“
„ Va bene . Dann komm mal mit.“
Читать дальше