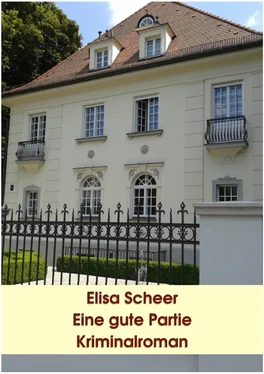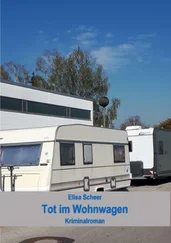1 ...8 9 10 12 13 14 ...22 „Nein!“, kreischte ich auf und mäßigte mich wieder, als mich überraschte Blicke trafen. Ich überlegte. „Nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Kann man nicht einfach auf gar nichts stehen?“
„Nein, kann man nicht“, behauptete Irina. „Jeder Mensch braucht Liebe.“
„Liebe... Du meinst Sex?“
„Nein. Sex auch, aber Liebe ist doch mehr, findest du nicht?“
Ich zuckte die Achseln. „Was ist Liebe? Begehren? Zuneigung? Argumentationshilfe? Einbildung? Hauptmotiv der Seifenopern? Wann liebt man jemanden? Wenn man von ihm abhängig ist? Ich bin gerne unabhängig. Ach, Irina, amüsier dich mit Peter und ärgere dich nicht mit mir herum, das lohnt sich nicht.“
„Unsinn. Du bist so eine Liebe, und eines Tages findest auch du einen Kerl, der dir klarmacht, wie viel Unsinn du eben geredet hast.“
„Vielleicht.“ Ich hatte auf das Thema schon wieder keine Lust mehr. „Aber dein guter Ben ist es leider nicht.“
„Macht nichts, der ist schon wieder versorgt.“
Irina stand auf und zog Peter auf die Tanzfläche. Eine Frau ließ sich neben mich aufs Sofa fallen, stellte sich als Heidi vor und verwickelte mich in ein Gespräch darüber, ob man Romane im Original oder in der Übersetzung lesen sollte. Wir verglichen die schönsten Stilblüten bekannter Übersetzer (offenbar hatten wir beide Dieter E. Zimmer gelesen) und waren uns schnell wundervoll einig – oder lag das am zweiten Bierchen?
Tim klatschte in die Hände. „Leute, fünf vor zwölf! Jeder nimmt sich Sekt! Und dann ab auf die Straße!“ Lachend und rufend trabten wir die knarzenden Holztreppen herunter und schauten zu, wie drei ganz wichtige Männer die Raketen in leeren Sektflaschen deponierten und dann Feuerzeug bei Fuß dastanden, während wir im Chor rückwärts zählten – der dröhnend laute Fernseher aus der Erdgeschosswohnung gab den Takt vor. Bei Null umarmte jeder jeden, wie üblich, und die Raketen wurden der Reihe nach gezündet. Zischend fuhren sie in den klaren Nachthimmel und explodierten in goldenen, grünen und purpurroten Sternen.
„Los, zum Geldautomaten! Und dann wieder nachtanken!“, rief Tim und ließ die leeren Flaschen mitten auf der Straße stehen. Irina und ich sahen uns an und räumten sie an den Straßenrand. Männer! Sie machten doch nichts als Unordnung!
Ich sah den anderen nach, wie sie um die Ecke rannten, und fand, da ich meine Tasche und meinen Mantel mit hinunter genommen hatte, könnte ich mich jetzt auch auf Französisch verdrücken. Das merkten die doch gar nicht mehr, und nach Mitternacht zogen diese Feste sich bloß endlos hin. Lieber lief ich zu Fuß nach Leiching, dann wurde der Kopf wieder klar.
Ein langer Weg, aber ich merkte es kaum. Hatte Irina Recht? Hatte ich Unsinn geredet? Warum war ich so misstrauisch? Irgendwie verkorkst vielleicht?
Nein, das war sicher übertrieben. Oder doch nicht? Woher konnte das kommen? Ich hatte Max – Max? Michael? Nein, Max – und Bernie nie als so traumatisch empfunden. Blöd, peinlich, unangenehm, ja – aber doch nicht schlimmer, als ein Gedicht vor der ganzen Klasse aufsagen zu müssen oder beim Referathalten im Seminar bei einem dicken Hund erwischt zu werden! Sex war kein Schock gewesen, nur eine gewisse Enttäuschung – und die altbekannte Frage, warum die Romane ein derartiges Gewese darum machten.
Hatte es daran gelegen, dass ich beide nicht besonders gut kannte? Dass sie mir als Menschen eigentlich egal waren? Aber da waren sie doch nicht die einzigen, oder? Waren mir nicht eigentlich alle Menschen ziemlich egal? Wenn hatte ich wirklich gern?
Diese Frage gab mir Stoff zum Nachdenken bis zur Leichinger Straße, die erst jenseits des nun ganz verlassenen Stadtrings anfing. Auf der Kreuzung blinkten die Ampeln gelb und unbeachtet, auf den Bürgersteigen lagen die himbeerroten Pappröhrchen, die von den Raketen übrig geblieben waren, in den Papierkörben und auch daneben steckten leere Sektflaschen, aber die feiernden Menschen hatten sich längst wieder ins Warme verzogen und feierten weiter.
Zurück zum Thema! , rief ich mich zur Ordnung und schritt energisch die Leichinger Straße entlang. Wenn hatte ich wirklich gerne? Mama? Manchmal schon, aber häufiger war das reines Pflichtbewusstsein. Sie war eben kränklich, und einer musste sich ja um sie kümmern. Papa? Wirklich nicht! Warum auch, er mochte mich doch auch nicht. Warum, wusste ich nicht – weil ich ihn verachtete? Weil er lieber einen zweiten Sohn gehabt hätte? Weil ich wusste, was er für ein erbärmlicher Wicht war? Ziemlich wirr, meine Gedanken – auch für ein Uhr morgens.
Tobi? Den konnte ich nicht leiden, und das war mir auch überhaupt nicht peinlich. Das beruhte ja auch auf Gegenseitigkeit; ich fand ihn gewöhnlich, egoistisch, machohaft und ganz allgemein widerlich. Was er von mir hielt, darüber wollte ich lieber nicht länger nachdenken.
Irina? Sie war nett, wirklich. Aber wenn sie morgen anrufen würde und sagen, das nächste Semester gedächte sie in Berlin oder Sydney oder wo auch immer zu verbringen – ich würde sie kaum vermissen. Bea auch nicht. Wer blieb da noch? Esther würde ich zwar gerne mal wieder sehen, aber ich brauchte sie auch nicht. Ich brauchte überhaupt niemanden. Und Männer schon gar nicht. Diesen Freddy, der mich bei stumpfsinnigen Verrichtungen begleitete, alles kommentierte und sie dann brav wegschicken ließ? Recht angenehm im Umgang, der Mann, so fügsam. Aber was sollte mir das? Nein, den würde ich auch nicht vermissen.
War ich eigentlich innerlich tot? Hing ich denn nicht wenigstens an meinem Studium, an der Kunst? Nein, auch nicht. Es freute mich, wenn ich Erfolg hatte, aber wenn ich nach dem Examen statt eines Jobs in der Kunstszene (Auktionshaus wäre nicht schlecht) nur irgendeine Schreibtischarbeit, vielleicht in der Straßenbauverwaltung oder so, bekäme, wäre mir das auch Recht, solange ich davon leben konnte.
Vielleicht liebte ich nur das Geld... Gesetzt den Fall, mein Depot bräche über Nacht zusammen: Wäre ich fix und fertig? Ja, musste ich zugeben, aber nur, weil ich dann erst später ausziehen konnte. Für eine eigene, egal wie winzige oder wie schäbige Wohnung hätte ich jeden Cent ausgegeben. Also liebte ich nur meine Selbständigkeit? So sah es wohl aus...
Mein ganzes Leben lang friedlich und alleine in einer kleinen, hässlichen Wohnung? Egal, das stellte ich mir richtig geruhsam vor. Von acht bis fünf arbeiten, dann eine Kleinigkeit zum Essen besorgen, meine Wohnung pflegen, gemütlich ein, zwei Stunden lesen, spazieren gehen, vielleicht ab und zu ins Kino (ohne jemanden, der dazwischen quatschte), einmal im Jahr ein neues Kleidungsstück, Tobi nie wieder sehen müssen... Schöne Vorstellung! Woher konnte ich noch Geld kriegen?
Schmuck besaß ich, ja, aber den konnte ich nicht einfach verkaufen. Zum Teil gehörte er der Familie (immer von der ältesten Tochter zu tragen), zum Teil hatte Mama mir früher mal Kleinigkeiten geschenkt. Sollte ich ausziehen, würde ich ihn natürlich zurücklassen. Was besaß ich sonst noch? Einen Stapel Lieblingsbücher, recht wenige, weil ich meist die Städtische Bibliothek frequentierte, einen Koffer voller Kleidung – und die achttausend Euro. Wenig für vierundzwanzig Jahre! Gut, noch eine Mappe voller Scheine und einen drei Jahre alten Rechner. Außerdem hatte ich Abitur, sprach fließend Französisch und konnte Auto fahren – auf mich hatte die Welt gewartet!
Die Welt brauchte mich nicht. Toller Gedanke. Immerhin, da vorne war der Zollhausweg, allmählich wurde mir ganz schön kalt. Niemand brauchte mich. Wer würde mich vermissen, wenn ich plötzlich verschwand? Wenn mich zum Beispiel jetzt jemand in ein Auto zerren würde und ich auf Nimmerwiedersehen im Orient...? Blödsinn, die standen bestimmt nicht auf Frauen wie mich.
Aber vermissen würde mich keiner. Der zittrige Professor nicht, der offenbar eine Heidenangst hatte, dass mir sein Themenvorschlag nicht gefiel, Irina und Bea nicht, Esther würde es gar nicht merken, Tobi fände, mir sei Recht geschehen und außerdem wollte er ohnehin alles erben, Mama müsste eben die Arbeit selbst machen. Unsinn, sie würde ihr eigenes Geld nehmen und jemanden engagieren. Und Papa? Papa wäre froh.
Читать дальше