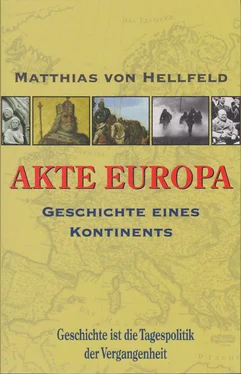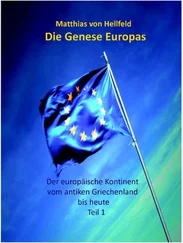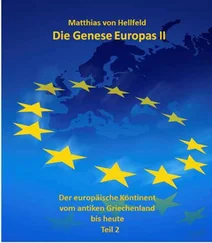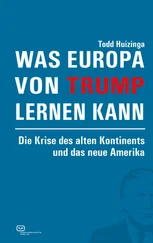Damit schlägt der englische König eine Bresche in die Struktur des französischen Königreichs und löst die Jahrhunderte alte lehensrechtliche Verzahnung des Landes auf. Was anfangs dem englischen König zu Gute kommt, birgt aber auch den Keim für ein französisches Nationalgefühl, das schließlich den Ausgang dieses Krieges wesentlich beeinflussen wird. Solange der englische König als Lehnsmann über Teile Frankreichs herrscht, stehen sich nicht „Engländer“ und „Franzosen“, sondern „Aquitanier“ und „Nordfranzosen“ gegenüber, die beide einen gemeinsamen König haben, der ihnen das jeweiligen Lehen gewährt. Als Eduard III. dieses Band durchschlägt, sorgt er unbeabsichtigt dafür, dass sich – ausgehend von Paris – ein Gefühl der Eigenständigkeit und nationaler Zusammengehörigkeit entwickelt. Dieses Gefühl geht über das alte Lehensrecht hinaus und verleiht dem Kampf gegen Eduard III. neue Schubkraft. Aus dem Kampf rivalisierender Landesherren ist das Ringen einer „Nation“ um ihr politisches Überleben geworden. Die Wende im englisch-französischem Krieg ist mit dem Namen einer Frau verbunden, die noch heute als sagenumwobene Historiengestalt bekannt ist: Jeanne d’Arc oder auch Johanna von Orleans.
Jeanne d’Arc wird am 6. Januar 1412 in Lothringen geboren, mit 13 Jahren hört sie „Stimmen“, die ihr angeblich befehlen, den französischen König zu besuchen und ihm bei der Vertreibung der Engländer vom kontinentaleuropäischen Festland zu helfen. Es gelingt ihr tatsächlich, eine Audienz beim Kronprinzen Karl VII. zu bekommen, der von dem Mädchen so angetan ist, dass er ihrem Ansinnen, die demoralisierten französischen Truppen bei Orleans in die Schlacht zu führen, schließlich nachgibt. Eine wahrhaft vaterländische Eingebung, denn unter der Führung der 17-Jährigen befreien französische Truppen am 8. Mai 1429 die eingeschlossene Stadt. Das bringt den scheinbar schon besiegten Franzosen Mut und Zuversicht zurück. Die Befreiung von Orleans ist die Wende in diesem Krieg, der zwar noch 24 Jahre dauern wird, aber mit der Räumung aller englischen Besitzungen auf dem französischen Festland endet. Nach dem Sieg von Orleans lässt sich Karl VII. in Reims zum König krönen. Auch hierbei folgt er dem Rat Jeanne d’Arcs, die ihm vorschlägt als Zeichen der Siegesgewissheit durch Gebiete zu reisen, die von englischen Truppen bedroht sind. Nach seiner Krönung braucht Karl VII. das Bauernmädchen nicht mehr. Jeanne d’Arc kämpft noch einige Monate weiter gegen die Engländer, wird aber am 23. Mai 1430 von deren burgundischen Verbündeten gefangen genommen. Doch undankbar für die erhaltene Hilfe, kümmert sich Karl VII. nicht um seine ehemalige Beraterin und lässt zu, dass es im Januar 1431 zu einem Ketzerei-Prozess gegen die junge Frau kommt, an dessen Ende Johanna von Orleans im Alter von 19 Jahren bei lebendigem Leibe auf dem Marktplatz von Rouen verbrannt wird. Die Geschichte der Johanna von Orleans ist mit ihrem Feuertod nicht beendet. Schon 25 Jahre später wird sie durch einen Prozess, den der reumütige Karl VII. einleitet, rehabilitiert. Jene, die das Feuer unter ihrem Körper gelegt hatten, werden aber verschont. Diese Zwiespältigkeit währt bis 1909, als Johanna von Orleans vom Vatikan zunächst selig und elf Jahre später heilig gesprochen wird.
Europa im 15. Jahrhundert
Für Frankreich bedeutet der Sieg über die britischen Feinde eine Stärkung der königlichen Autorität und des nationalen Zusammengehörigkeitsgefühls der Franzosen. Ähnliche Entwicklungen lassen sich in Ungarn und Russland feststellen. Auch der englische König Heinrich VII., der von 1485 bis 1509 regiert, stärkt die königliche Macht auf Kosten des Adels. In Spanien bilden sich die Königreiche Kastilien und Aragon heraus, die gemeinsam die Vertreibung der „heidnischen“ Mauren von der iberischen Halbinsel bewerkstelligen. Auch wenn es für die europäischen Staaten von apokalyptischen Schreckensvisionen begleitet ist, festigt das osmanische Reich seine Machtposition durch die Einnahme Konstantinopels im Jahr 1453. Mit der Besetzung Konstantinopels flüchten christliche Künstler nach Europa und befruchten dort die bald beginnende Renaissance. In Deutschland und vor allem in Ungarn und Österreich sorgt man sich vor weiteren Expansionen der Osmanen, die nunmehr den einzigen Hafen zum Schwarzen Meer kontrollieren und damit den Handelsweg nach Indien versperren. Die Kaufleute suchen neue Handelsrouten und schaffen so die Voraussetzung für die Entdeckung einer neuen Welt durch Christoph Columbus 1492, der alternative Handelswege erkunden soll und dabei – eher zufällig – Amerika entdeckt.
In Deutschland bewirkt die Sorge vor einer türkischen Expansion, dass der in Untätigkeit verharrende Kaiser Friedrich III. aus seiner Lethargie erwacht und 1454 eine Reichsversammlung nach Regensburg einberuft. Dort allerdings zeigen ihm die Fürsten die Grenzen seines Handlungsspielraums auf. Sie beschweren sich zunächst, dass in deutschen Landen Streit und blutige Zwietracht an der Tagesordnung sind. Anschließend führen sie den Kaiser am Nasenring durch die politische Arena ihrer Tage, wie man in der Beschlussfassung der Reichsversammlung. Wenn – so die Annalen des Markgrafen Albrecht Achilles – den Türken mit Unterstützung der Kurfürsten Widerstand geleistet werden solle, dann müsse der Kaiser erstmal Ruhe und Ordnung herstellen. Dann, aber erst dann, würden die Kurfürsten den „ungläubigen Türken und allen anderen Widerwärtigkeiten, ungebührlichem Bedrängen und Einbrüchen anderer Völker in deutsches Land Widerstand leisten.“ Wenn die Voraussetzungen erfüllt seien, dann würden die Kurfürsten dem „Römischen Kaiser gerne wieder gehorchen.“ Die Frage ist nur, wie seine kaiserliche Majestät dies anstellen soll, ohne tatsächliche Machtbefugnis im „heiligen Reich deutscher Zunge“ zu haben. Weder Friedrich III. noch sein Nachfolger Maximilian I. können den Frieden des Reiches garantieren, es fehlt ihnen an finanziellen und militärischen Mitteln, um die widerstrebenden Interessen unter einen Hut zu bringen. Der Druck, die rechtliche und politische Situation zu ändern, ist also zwingend notwendig. Ein nach Worms einberufener Reichstag bringt im Jahr 1495 die gesamtstaatliche Reform des deutschen Reiches, das damit zu einem einheitlichen Rechtsraum wird.
Die wichtigste in Worms beschlossene Neuerung ist die Verkündung des „ewigen Landfriedens“, der ein Verbot der Selbstjustiz durch das Fehderecht einschließt. Von nun an werden Streitigkeiten vor einem Reichskammergericht ausgetragen, das ständig tagt und weitreichende Kompetenzen hat. Bis 1806, dem Ende des „Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation“, ist dieses Gericht die oberste Gerichtsinstanz im Reich. Es stärkt einerseits die Position des Kaisers, der nun wieder Ruhe und Ordnung auf den Handelswegen garantieren kann. Aber Maximilian I. muss auch Kompromisse eingehen, denn die Fürsten bestimmen, wer in diesem Reichskammergericht, das in Frankfurt tagt, Recht spricht. Während der Kaisers also einerseits mit dem Reichskammergericht Landfrieden sicherstellen kann, ist das Gericht andererseits vom König unabhängig, was die Position der Reichsstände, also der Territorialfürsten und der Städte, stärkt. In Worms wird außerdem die erste Reichssteuer beschlossen. Mit dem so genannten „gemeinen Pfennig“ sollen die Ausgaben des Staates gedeckt werden. Auf dem Papier liest sich das wie ein zufrieden stellender Kompromiss zwischen den konkurrierenden Mächten im Lande. Tatsächlich aber gibt es immer wieder Streitigkeiten über die Umsetzung dieser Beschlüsse, weil die Fürsten ihrer Steuerpflicht nur zögerlich nachkommen und weil sie noch längere Zeit versuchen, das ihnen lieb gewordene Fehderecht aufrecht zu halten. Langfristig aber bedeuten die Entscheidungen des Wormser Reichstags die Garantie der Reichseinheit, die verbunden ist mit einem einheitlichen Recht und dem Verbot der Selbstjustiz. Fortan wird Deutschland von einem Kaiser und den Reichsständen regiert, die sich in einem System von gegenseitiger Kontrolle und Abhängigkeit befinden. Dieser Dualismus ist die Grundlage des Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland.
Читать дальше