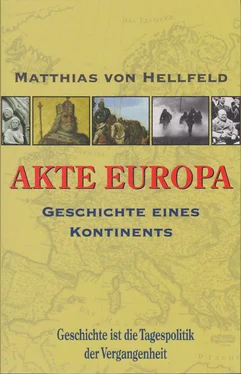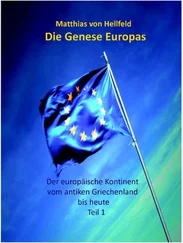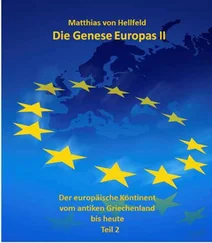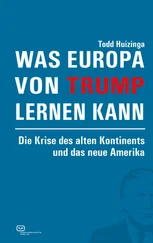Christliche Judenfeindschaft
Nicht besser ergeht es der jüdischen Bevölkerung, die in einem Zuge mit Hexen und Ketzern ebenfalls einer brutalen Verfolgung der Christenheit ausgesetzt ist. Juden werden als Verursacher allen Übels an den Pranger gestellt. Unsinnige religiöse Vorurteile müssen wider besseres Wissen herhalten, um Juden pauschal und kollektiv als Handlanger des Bösen brandmarken zu können. Wo es zu Naturkatastrophen, schlimmen Krankheiten oder Epidemien kommt, ist auch immer die Blutspur einer gewalttätigen Judenfeindschaft der Christen zu finden. Zur Zeit der Pest, die zu allem Überfluss die Menschen in Europa zwischen 1347 und 1352 auf eine dramatische Weise heimsucht und 25 Millionen Opfer fordert, finden Judenmassaker in Colmar, Frankfurt, Köln oder Hannover statt. Auch in Straßburg wird die jüdische Bevölkerung verantwortlich gemacht für den „schwarzen Tod“, der die Einwohnerschaft um mehr als die Hälfte dezimiert. Die aufgebrachte Stimmung der Menschen schildert der zeitgenössische Chronist Jakob Twinger von Königshofen:
„Wegen dieser Pest verleumdete man die Juden in der Welt und bezichtigte sie, dies verursacht zu haben, indem sie Gift in das Wasser und die Brunnen getan hätten. Darum wurden die Juden vom Meer bis nach Deutschland verbrannt. (…) In Basel zog das Volk auf das Richthaus und zwang die Ratsherren zu schwören, sie wollten die Juden verbrennen und zweihundert Jahre lang keinen mehr in die Stadt lassen. (…) An diesem Freitag fing man auch die Juden in Straßburg, und am Samstag verbrannte man sie auf einem hölzernen Gerüst in ihrem Kirchhof, es waren zweitausend. (…) Was man den Juden schuldig war, galt als bezahlt, alle Pfänder und Schuldbriefe wurden zurückgegeben. Das Bargeld der Juden nahm der Rat und verteilte es unter das Handwerk. Das Geld war auch die Ursache, warum die Juden getötet wurden, wären sie arm und die Landesherren ihnen nichts schuldig gewesen, so hätte man sie nicht verbrannt.“
Antisemitismus ist nicht nur damals ein schwer zu durchbrechendes Gedankengemisch aus Raub- und Mordgier und einer Dämonisierung der Menschen jüdischen Glaubens. Der Mord von Straßburg, den uns der Stadtchronist Jakob Twinger in aller Offenheit überliefert hat, geschieht aus Habgier, denn mit dem Tod der Juden sind auch die Schuldscheine erloschen, die die Christen vorher unterschrieben haben. Unter dem Deckmantel, die Pest zu bekämpfen, verschwindet das kollektive Gewissen, das vorher schon durch ein geradezu schwachsinniges Gebräu von Vermutungen und Unterstellungen eingelullt worden ist. Vom Kreuz der Christen, an dem einst der Religionsgründer und Friedensprediger Jesus von Nazareth gehangen hat, tropft fortan das Blut der Juden, denen man nicht nur den Tod des Gottessohnes in die Schuhe schiebt. Unterstützt und angefeuert von ihrem Papst erklären die Christen die Juden zu kaum bezwingbaren Übermenschen, derer man sich nur durch präventiven Mord entledigen kann. Die Christen sehen sich in der Rolle des kleinen Davids, der den scheinbar unbezwingbaren Goliath vor sich hat. Den Juden werden übermenschliche Fähigkeiten unterstellt, weshalb sie auch von der Pest weniger betroffen seien als die Christen. Die Juden verführten mit ihrer schier unendlichen Potenz christliche Frauen und vermischten so die Blutgemeinschaft der Christen. Der „ewige Jude“ Ahasver sei – so die Legende – deshalb zur immer währenden Wanderung über den Erdball verdammt, weil er Christus verhöhnt und geschlagen und ihm beim Gang nach Golgatha eine kurze Rast versagt habe. Und schließlich hätten die Juden den Sohn Gottes ans Kreuz genagelt und seien schon deshalb ein übles Pack. Dieser Unsinn verschließt sich gegen die Tatsache, dass es die römischen Besatzer Jerusalems gewesen sind, die Jesus ans Kreuz geschlagen haben.
Dabei gibt es für die Pest in der Mitte des 14. Jahrhunderts ganz handfeste Gründe, die weder etwas mit religiösen Vorstellungen noch mit der Zugehörigkeit zu einer Bevölkerungsgruppe zu tun haben. Der „schwarze Tod“, dem vermutlich 30 Prozent der damaligen Bevölkerung Europas zum Opfer fallen, ist eine von Ratten ausgelöste, durch Flöhe auf Menschen übertragene bakterielle Epidemie, die sich wegen der katastrophalen hygienischen Umstände rasend schnell und unaufhaltsam auf dem ganzen Kontinent ausbreitet. Der in Paris geborene Dichter Giovanni Boccaccio beschreibt in seiner bis heute berühmten Novellensammlung „Decamerone“, wie eine Handvoll junger Adliger vor der Pest aufs Land fliehen und sich den Genüssen des Lebens hingeben. Über die Pest schreibt Boccaccio:
„Diese Pest war deshalb so gewaltig, weil sie, wenn die Menschen miteinander verkehrten, von solchen, die bereits erkrankt waren, auf Gesunde übergriff, nicht anders als es das Feuer mit trockenen und fetten Dingen tut, wenn sie in seine Nähe gebracht werden. Und es kam noch schlimmer: Denn nicht nur das Sprechen oder der Umgang mit den Kranken infizierte die Gesunden mit der Krankheit und dem Keim des gemeinsamen Todes, sondern es zeigte sich, dass allein die Berührung der Kleider oder eines anderen Gegenstandes, den die Kranken angefasst oder gebraucht hatten, den Berührenden mit dieser Seuche ansteckte."
Am Ende der Seuche fehlt es überall an Arbeitskräften, die Preise verfallen, gefolgt von einer flächendeckenden Verarmung. Zweifellos herrscht in Europa tiefe Depression, weil die Pest nicht die einzige Katastrophe dieser Jahre ist und weil es keine Aussicht auf Besserung zu geben scheint. In Deutschland sitzt Mitte des 15. Jahrhunderts mit dem Habsburger Friedrich III. ein ziemlicher …
Die geopolitische Zerfaserung Deutschlands
1440 – 1495
… Langweiler auf dem Thron. Friedrich III., der seit 1440 als König und ab 1452 auch als Kaiser regiert, macht sich einen Namen als Partyschreck, weil er ganz gegen die Gewohnheiten seiner Zeitgenossen Feierlichkeiten und übermäßigem Alkohol-Konsum meidet. Gängige Urteile über ihn reichen von „schwerfällig und ohne Tatkraft“ und „Erzschlafmütze“ bis „schlaff und quallig“. Sicher scheint zu sein, dass er sich von aktuellen politischen Krisen nicht über Gebühr erregen lässt. Er ist mit seinen Aufgaben sichtlich überfordert und fast ausschließlich damit beschäftigt, das habsburgische Erbland zu sichern. Sein Wahlspruch: „Alles Erdreich ist Österreich untertan“ ist bei Friedrich III. Programm. Dabei steht es um das deutsche Reich an der Schwelle zur Neuzeit schlecht, die Verfallserscheinungen sind unübersehbar. Mit dem weiteren Aufstieg der Territorialherren gelangt das mittelalterliche Kaisertum unter Friedrich III. zunächst an einen neuen Tiefpunkt. 1473 verhandelt der König von Burgund mit dem Habsburger um die Übernahme der deutschen Kaiserkrone. Die Verhandlungen scheitern, aber sie zeigen, welchen Stellenwert die Krone für Friedrich III. hat. Dennoch gelingt es dem Kaiser während seiner Regentschaft, die allein deshalb so lange währt, weil er Konkurrenten und Gegner überlebt, das habsburgische Erbland erheblich zu erweitern und so die Basis für das nahezu ganz Europa umspannende Reich seines Sohnes Maximilian I. und dessen Enkels Karl V. zu legen. Friedrich III. trägt über 40 Jahre die deutsche Kaiserkrone und garantiert allein dadurch eine gewisse Stabilität, bis er 1493 in Linz eines natürlichen Todes stirbt.
Der französisch – englische Krieg
Während sich Deutschland machtpolitisch weiter zerteilt, gelingt es dem französischen König, die Autorität der Zentralgewalt zu stärken und so die Grundlagen des französischen Staates zu festigen. Die Bretagne und Burgund werden der Krondomäne wieder einverleibt, die Macht der Territorialfürsten damit erheblich beschnitten. 1453 endet außerdem der Hundertjährige Krieg zwischen Frankreich und England, bei dem es um nichts weniger als die französische Krone gegangen ist. Auslöser dieses Krieges ist der Tod des letzten kapetingischen Königs Karl IV. im Jahr 1328. König Eduard III. will die englischen Besitzungen in Frankreich zurück erobern, die sich sein französischer Amtskollege Philipp VI. – in Ermangelung männlicher Erbfolge bei den Kapetingern – als „verfallenes Lehen“ angeeignet hatte. Philipp VI. sieht wenig Übles in seiner Handlung, weil für ihn Eduard III. in seiner Funktion als Herzog von Aquitanien nichts weiter als ein Lehnsmann ist, der seine Besitzungen auf französischem Boden der Belehnung durch ihn – Philipp VI. - zu verdanken hat. Aber anstatt ihm Treue zu erweisen, fegt Eduard III. dieses überlieferte Recht als Lappalie vom Tisch und setzt mit einer gewaltigen Streitmacht über auf das europäische Festland.
Читать дальше