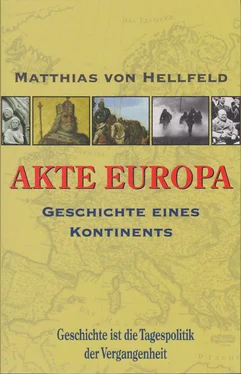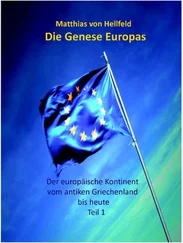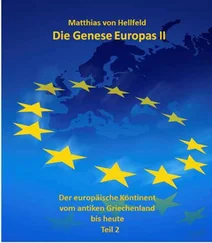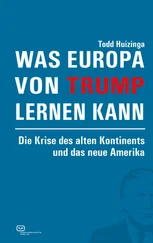Die unruhige Mitte des Kontinents
Das deutsche Reich in der Mitte des europäischen Kontinents ist in diesen Jahren einer Zerreißprobe ausgesetzt. Zum einen hat die zeitweilige Verlagerung des politischen Augenmerks der deutschen Kaiser auf ihre Vormachtstellung in Italien eine Destabilisierung Deutschlands zur Folge. Zum anderen zeigt sich, dass jede Veränderung der politischen Ordnung in der Mitte des europäischen Kontinents auch die Interessen, die Sicherheitsbedürfnisse und die Machtgelüste der Nachbarn tangiert. Wer in deutschen Landen regiert und wer wie viel Macht in diesem Teil Europas ausübt, sind keine Fragen, die die Deutschen allein beantworten können. Die politische Situation der Mitte betrifft auch die politische Situation der Ränder des Kontinents. Ohne es zu wollen und ohne es ändern zu können, bewirkt die geographische Lage der Deutschen deren Abhängigkeit von den vielen Nachbarn, die ihr Land umgeben. Auch Frankreich hätte sich liebend gerne zur abendländischen Nachfolgemacht des großen römischen Reiches aufgeschwungen, wie der Versuch nach der deutschen Krone zu greifen am Beginn des 14. Jahrhunderts zeigt. Denn damit wäre der französische König – zumindest auf dem Papier - Herrscher über Frankreich, Deutschland und weite Teile Italiens gewesen, hätte seinen Anspruch auf die Kaiserkrone anmelden können und sich mit dem schmückenden Zusatz „augustus“ anreden lassen dürfen. Der später aufkommende Begriff der „deutschen Frage“ für die politische Konstellation Zentraleuropas hätte dann „französische Frage“ geheißen.
Politische Partizipation in Deutschland
Der machtpolitische Spagat zwischen Deutschland und Italien, den die deutschen Kaiser seit der Aufteilung des Reichs Karls des Großen vollführen, hat den Aufstieg der Herzöge und Fürsten befördert. Zweifellos haben deren eigene Machtinteressen zu den teilweise chaotischen Zuständen am Beginn des 14. Jahrhunderts geführt. Der Umstand, dass in den letzten Jahrzehnten mehrfach Ausländer auf dem deutschen Königsthron gesessen haben, wird einer Identifikation der Menschen mit „ihrer“ Krone eher im Wege gestanden haben. Aber das politische Taktieren um mehr Macht und Einfluss auf die Führung des deutschen Reiches schafft ein System von Gegengewalten. Die Fürsten erstreiten immer mehr Teilhabe an den politischen Entscheidungen ihrer Zeit – mit einem Begriff von heute würde man das „politische Partizipation“ nennen. Ein schwacher König und starke Territorialherren: beide Seiten können nicht ohne den anderen handeln, so wird Despotie und Machtmissbrauch – wenigstens weitestgehend – verhindert. Und noch etwas entspringt dieser politischen Situation: die Städte. Sie werden immer mächtiger und einflussreicher, vergeben eigene Rechte und Privilegien, schützten ihre Bürger und entwickelten ihre eigenen Identitäten, die zum Teil bis heute überdauert haben. Das gilt auch für Frankreich, wo schon 1302 die erste „Ständeversammlung“ abgehalten wird, der die Städte, der Klerus und der Adel angehören. Die gegenseitige Kontrolle der politischen Machthaber in Deutschland wird im Laufe der Geschichte immer wieder mal außer Kraft gesetzt, sie hat sich aber letztlich bis in unsere Tage erhalten. Keine Bundesregierung kann das Deutschland regieren, ohne die Belange der Bundesländer zu berücksichtigen. Und umgekehrt kann kein Bundesland, die Politik der Bundesregierung so torpedieren, dass sie langfristig handlungsunfähig wird.
Die starken Fürsten haben erstritten, dass der deutsche König von ihnen gewählt wird. Das Wahlentscheidende kurfürstliche Kollegium setzt sich aus den drei geistlichen Kurfürsten von Köln, Mainz und Trier und ihren weltlichen Kollegen aus Böhmen, Sachsen, Kurpfalz und Brandenburg zusammen. Dieses Gremium ist mit Angehörigen des Klerus und des Adels nahezu paritätisch besetzt – ein kluger Schachzug, wie sich bei den Verhandlungen mit Kaiser Karl IV. über ein entsprechendes Verfassungsdokument herausstellt. Dieses mit dem zur Depression neigenden Kaiser verabredete Dokument ist das bis dahin wichtigste Gesetz des deutschen Reiches, es hat den Charakter eines Grundgesetzes und wird bis 1806 seine Gültigkeit behalten. Die wegen des goldenen Königssiegels so genannte „Goldene Bulle“ des Jahres 1356 legt fest, dass bei einer Königswahl das Mehrheitswahlrecht gilt. Da es dank dieser Regelung immer ein Wahlergebnis geben muss, sind innerdeutsche Kriege um die Thronfolge ebenso ausgeschlossen wie die Erhebung eines Gegenkönigs. Durch die Einführung des Mehrheitsprinzips wird außerdem eine lähmende Pattsituation vermieden, die Vakanzen auf dem Königsthron nach sich ziehen würde. Damit ist verhindert, dass eine Königswahl in Deutschland zum Tummelplatz ausländischer Interessen wird. Mit der „goldenen Bulle“ ist aber auch garantiert, dass es immer einen König geben wird, dem nach seiner Wahl in Frankfurt und seiner Krönung in Aachen das Anrecht zusteht, vom Papst zum Kaiser des „Heiligen Römischen Reiches“ gekrönt zu werden. Der Papst kann in Zukunft nicht mehr selbst entscheiden, ob er einen deutschen König zum Kaiser krönt. Dafür hat er aber über „seine“ geistlichen Kurfürsten direkten Zugang zu der sehr viel wichtigeren Entscheidung – nämlich wer deutscher König wird!
Neben der Befriedung des Verhältnisses zwischen Kaisern und Päpsten bedeuten diese Regelungen, dass es in Zukunft keine „könig- oder kaiserlosen“ Zeiten mehr geben wird. Die Kurfürsten lassen sich diese Zusicherung gut bezahlen. Sie erhalten ein eigenständiges Münz- und Zollrecht, dürfen unbeschränkt Gebiete erwerben und ihr kurfürstliches Wahlprivileg vererben. Die ohnehin schon mächtigen Territorialfürsten, deren so genanntes Kurland fortan nicht mehr geteilt werden darf, weiten ihre Macht noch dadurch aus, dass sie die kaiserlichen Machtbefugnisse an die Zustimmung eines Reichstags binden, ohne den der Kaiser nahezu nichts entscheiden kann. Der Reichstag, in dem neben den Landesherren auch die Reichsstädte vertreten sind, entscheidet über Krieg und Frieden ebenso wie über Steuern. Mit diesem System kann der weitere Zerfall des Landes zwar aufgehalten werden, aber die äußere Macht des deutschen Reichs bleibt begrenzt. Die eigentlichen Herrscher sind nicht die Könige sondern die Kurfürsten. Während sich mit der „Goldenen Bulle“ des Jahres 1356 in Deutschland eine Stabilisierung der politischen Verhältnisse zu Gunsten der Kurfürsten abzeichnet, gerät die mittelalterliche Welt des 14. Jahrhunderts durch drei weitere Ereignisse in Turbulenzen, deren Folgen sich für die Menschen in Europa verheerend auswirken.
Das abendländische Schisma
1378 wird der aus Neapel stammende Bartolomeo Prignano als Urban VI. zum Oberhirten der Christen erwählt. Papst Urban VI. erweist sich – trotz einer beachtlichen akademischen Karriere – als unbeherrscht, starrsinnig und geradezu skrupellos. Sein Verhalten ist autoritär und rechthaberisch, zudem werden ihm mafiöse Strukturen und Vetternwirtschaft nachgesagt. Er zerrüttet die päpstlichen Finanzen, weil er unablässig militärische Auseinandersetzungen vor allem in Sizilien zu finanzieren hat. Innerhalb des Kardinalkollegiums formiert sich Widerstand, den Urban VI. mit erschreckender Brutalität unterdrückt. Auch das römische Volk revoltiert gegen ihn, doch Urban VI. denkt weder an Einlenken noch an Rücktritt, woraufhin die Kardinäle die Wahl für ungültig erklären und mit Clemens VII. einen Gegenpapst wählen.
Der neue Papst geht mitsamt einem eigenen Kardinalskollegium im September 1378 nach Avignon, wo die apostolischen Betten von seinem Vorgänger, der erst ein Jahr zuvor aus dem französischen Exil nach Rom zurück gekommen ist, noch warm sind. Mit der Wahl eines Gegenpapstes beginnt das abendländische „Schisma“, also die „Trennung“ der römischen Kirche in zwei rivalisierende Teile, von denen beide behaupten den rechtmäßigen Vertreter des Apostelfürsten Petrus auf Erden zu stellen. Es kommt noch schlimmer: Am 26. Juni 1409 wird auf dem Konzil von Pisa ein dritter Papst – Alexander V. – gekürt, der sowohl Gregor XII. als auch Benedikt XIII. - die beiden inzwischen amtierenden Gegenpäpste - exkommuniziert, weil diese sich weigern ihn anzuerkennen. Diese Turbulenzen führen zur religiösen Spaltung Europas: Alexander V. erfährt nur in Frankreich, England und einem Teil Deutschlands Anerkennung, während sich der deutsche König und zahlreiche deutsche Fürsten sowie Rom und Neapel für Gregor XII. erklären; der dritte im Bunde - Benedikt XIII. von Avignon - versammelt seine Anhänger auf der Pyrenäenhalbinsel und in Schottland.
Читать дальше