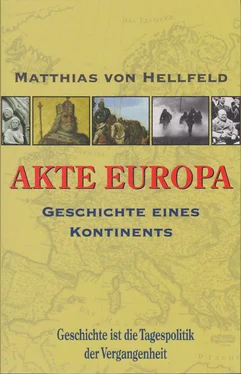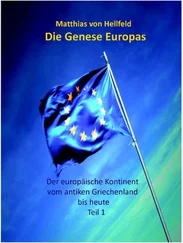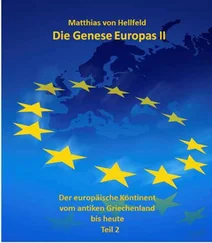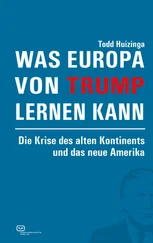Machtkämpfe in Deutschland
Im deutschen Reich ist derweil mit Heinrich VI., einem Sohn Friedrichs I. Barbarossa, ein Mann Kaiser geworden, der einen Beleg für besessenes Streben nach allumfassender Macht abgibt, die zur Durchsetzung eigener Interessen keinerlei Rücksicht auf andere nimmt. Nach einem Eroberungsfeldzug gegen die Normannen, der 1191 mit einer erzwungenen Kaiserkrönung durch Papst Coelestin III. beginnt und drei Jahre später mit seiner Krönung zum König von Sizilien endet, entwickelt Heinrich VI. weltumspannende Interventionspläne. Getrieben von unbändigem Ehrgeiz will er das alte Römische Reich unter staufischer Führung wieder aufrichten. Der Plan einer staufischen Universalherrschaft reicht bis von Konstantinopel bis zum afrikanischen Küstenstreifen zwischen Tunis und Tripolis, Zypern und Armenien und Jerusalem. Der frühe Malariatod des Kaisers in Messina am 28. September 1197 verhindert die Umsetzung dieser Vorstellung und macht den Weg frei für seinen Sohn Friedrich II.. Mit dem Tod Heinrichs VI. nimmt auch der Streit zwischen Staufern und Welfen um die Macht im deutschen Reich an Heftigkeit zu. Exponenten dieser bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzung sind der Welfe Otto IV. und der Staufer Friedrich II..
Otto IV. ist das Kind von Mathilde von England und Heinrich dem Löwen. Er wächst in der fürsorglichen Umgebung des englischen Königs Richard I. Löwenherz auf, der ihm die Grafschaft York und den Titel Herzog von Aquitanien überträgt. Aquitanien liegt mitten in Frankreich, nördlich der Dordogne bis zur Stadt Limoges. Als Heinrich VI. 1197 verstirbt, hat sein Sohn Friedrich II. gerade erst das Laufen gelernt, kommt also als aktiver Regent nicht in Frage. Das nun entstehende Machtvakuum nutzen die Welfen und laden Richard I. Löwenherz zur Teilnahme an einer Königswahl nach Köln ein. Richard I. Löwenherz nimmt dankend an, weil er einen geeigneten Kandidaten im Kopf hat. Er schlägt seinen welfischen Ziehsohn Otto IV. vor, der zwar nicht unumstritten ist, aber durch das Wort des englischen Königs machtvolle Unterstützung erfährt. Diesem Umstand Folge leistend, wird er durch den Erzbischof Adolf von Köln am 12. Juli 1198 mit nachgebildeten Insignien zum König gekrönt.
1198 kommt es zu einer Doppelwahl, denn nur wenige Kilometer rheinaufwärts haben sich die Staufer in Mainz versammelt und wählen ihrerseits Philipp von Schwaben, den jüngsten Sohn des legendären Friedrich I. Barbarossa, zum König. Ihr Nachteil: Sie können sich nicht auf eine legitime Krönung wie die durch den Kölner Erzbischof bei Otto IV. berufen. Diese Doppelwahl von 1198 ist der Beginn einer heftigen Auseinandersetzung um das Erbe der Kaiserkrone in Deutschland, die man den staufisch-welfischen Dualismus nennt. Die Entscheidung fällt nicht in Deutschland sondern in Italien, weil Papst Innozenz III. die Rolle des Schiedsrichters in diesem innerdeutschen Streit um die Thronfolge beansprucht. Nicht ohne Hintersinn, denn der Vatikan ist abhängig von den machtpolitischen Konstellationen in Oberitalien und – wie sich jetzt herausstellt – auch in Sizilien. In Deutschland ist der Streit um die Krone in vollem Gange, so dass Philipp von Schwaben und Otto IV. im Juli 1206 in der Schlacht von Wasserburg aneinander geraten. Als Otto IV. verliert, wendet sich der Papst von ihm ab und signalisiert dem siegreichen Philipp von Schwaben seine Unterstützung. Aber gerade als der sich anschickt, die Thronfolge anzutreten, wird er am 21. Juni 1208 durch den bayerischen Pfalzgrafen Otto II. von Wittelsbach ins Jenseits befördert. Die politischen Zustände geraten außer Kontrolle, denn nun ist der Weg wieder frei für Otto IV. trotz dessen schmählicher Niederlage zwei Jahre zuvor. Otto IV. richtet sein Augenmerk auf die Wiederherstellung der Reichsgewalt in Oberitalien und Sizilien und kalkuliert die geopolitische Umzingelung des Vatikans ein. Am 4. Oktober 1209 erscheint er bei Papst Innozenz III. und erreicht unter Androhung von Gewalt und Auflistung falscher Versprechungen seine Krönung zum römischen Kaiser.
Nun schlägt die Stunde von Friedrich II., dem „Knaben aus Apulien“, wie er etwas verniedlichend genannt wird. Um diesen zweifellos faszinierenden mittelalterlichen Herrscher ranken sich von der Geburt bis zum Tod Gerüchte und Legenden. Angeblich auf einem Marktplatz geboren, wächst er in „ungeordneten“ Verhältnissen auf. Er wird als ungehobelt, keinen Widerspruch duldend, ja geradezu frech geschildert. Zwar wohnt der Knabe im königlichen Palast von Palermo, die meiste Zeit jedoch treibt er sich im bunten Völkergemisch Palermos herum, lernt die Sprachen der verschiedenen Volksgruppen und ist auf mildtätige Gaben der Bürger angewiesen, die den kleinen Prinzen, mit dem was übrig ist, über Wasser halten. Für den künftigen König ist das Leben auf der Straße offensichtlich eine ertragreiche Schule für das Leben. Er lernt, wie das Volk lebt, sieht Gutes und Schlechtes, erfährt von Eigensucht und Verrat. Dennoch grenzt es an ein Wunder, dass der junge Mann in diesen Jahren nicht verwahrlost, sondern es offenbar versteht, sich die Grundlagen für seine bedeutende Herrschaft zu erarbeiten.
Eine Kehrtwende nimmt sein Leben, als er die zehn Jahre ältere Konstanze von Aragon heiratet. Diese Ehe kommt auf Vermittlung des Papstes zustande, der seit dem Tod seiner Mutter auch sein Vormund ist. Konstanze ist anfangs irritiert über das ungehobelte Verhalten ihres jugendlichen Ehemanns. Sie wird den Verdacht nicht los, Friedrich habe sie vor allem wegen der opulenten Mitgift geehelicht. Aber ihr Schock wandelt sich rasch in tiefe Zuneigung, die von Friedrich II. erwidert wird. Konstanze von Aragon ist wohl der erste Mensch, zu dem er ohne Vorbehalte Vertrauen entwickelt. Von ihr wird er in das Zeremoniell des höfischen Lebens eingeführt, sodass sein Image sich alsbald von dem eines ungehobelten Klotzes zu dem eines charmanten Mannes wandelt, der seine mittlerweile verfeinerten Lebensgewohnheiten mit einem für diese Zeit ungewöhnlichen täglichen Bad krönt.
Aber das Leben Friedrichs II. besteht nicht nur aus den Wonnen des Ehelebens, denn als sich Otto IV. daran macht, Sizilien einzunehmen, löst er bei Papst Innozenz III. schwere Angstzustände aus. Der Heilige Vater sieht den Kirchenstaat von Norden und Süden umklammert und belegt den Urheber dieses Albtraums umgehend mit dem Kirchenbann. Damit tut er Friedrich II. einen großen Gefallen, da die wankelmütigen Fürsten in Deutschland sofort von Otto IV. abfallen und den jungen König von Sizilien, Friedrich II., zum deutschen König wählen. Daraufhin eilt Otto IV. nach Deutschland zurück, kann aber den Siegeszug Friedrichs II. nicht mehr aufhalten. Nach einer weiteren militärischen Niederlage schwindet sein Einfluss mehr und mehr, bis er schließlich auf einige norddeutsche Gebiete beschränkt ist. Ende Juni 1218 stirbt mit Otto IV. der einzige römische Kaiser aus dem Haus der Welfen.
Der Weg ist frei für Friedrich II., der sich sofort an die Absicherung seiner eben gewonnenen Position macht. 1220 lässt er sich von Papst Honorius III. zum Kaiser krönen, stimmt einer Erweiterung des Kirchenstaats zu und verzichtet auf einige kaiserliche Rechte innerhalb der Kirche. Da immer noch Ungemach über das frevelhafte Verhalten der „Heiden“ in Jerusalem an die päpstlichen Ohren dringt, verspricht Friedrich II. außerdem einen Kreuzzug zu organisieren. Das Verhältnis zwischen dem Papst und dem frisch gebackenen Kaiser scheint also in Ordnung zu sein, aber die Eintracht zwischen den beiden währt nicht lange, denn Friedrich II. hat nicht nur einen Bund mit einigen oberitalienischen Städten geschlossen, sondern beginnt unmittelbar nach seiner Krönung mit brutaler Härte den Adel in Sizilien zu unterdrücken. Wie vorher bei Otto IV. reagiert der Papst vorhersehbar: Eine machtpolitische Umzingelung durch den deutschen Kaiser, den er zu allem Unglück auch noch selbst gekrönt hat, kann er nicht widerspruchslos hinnehmen. Er belegt den Kaiser mit dem Kirchenbann.
Читать дальше